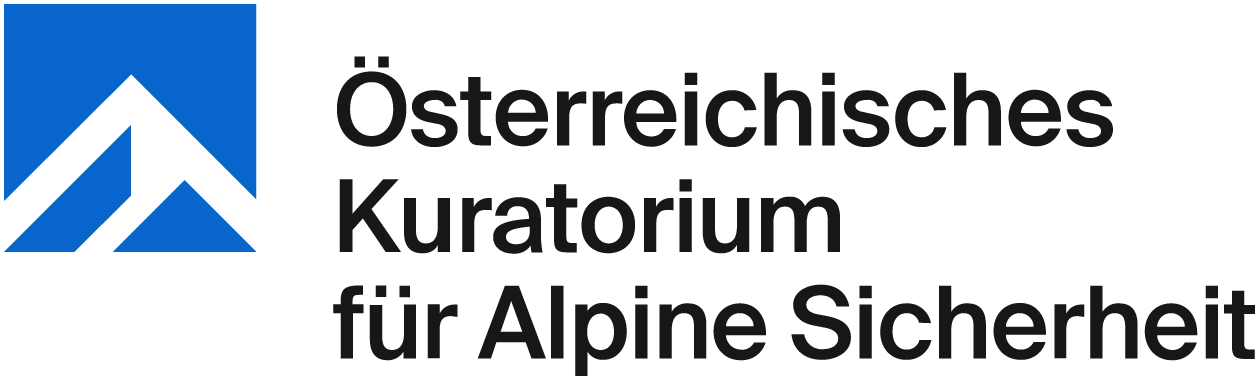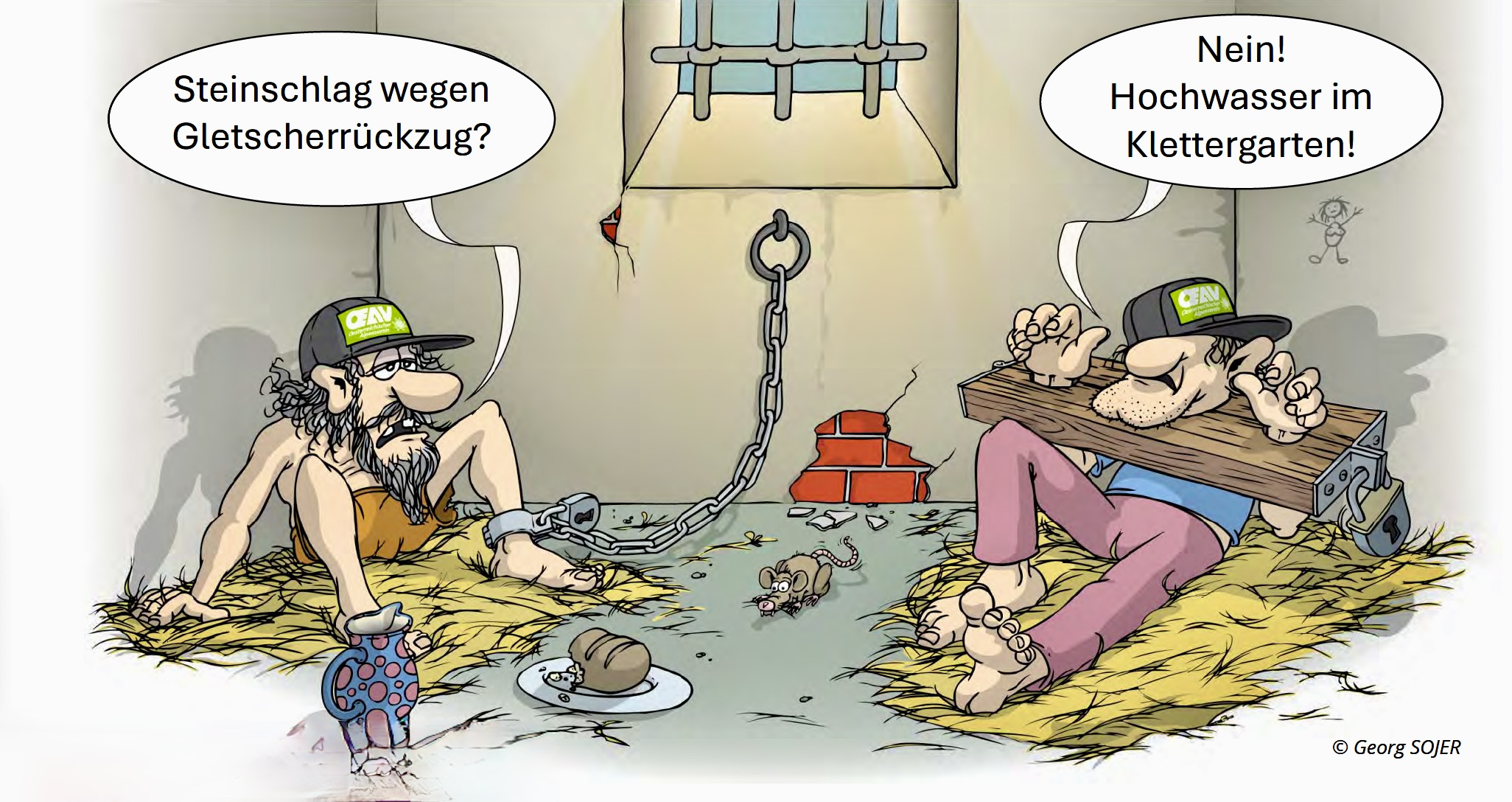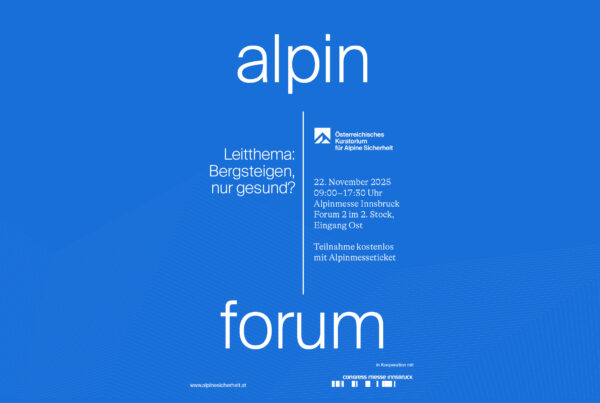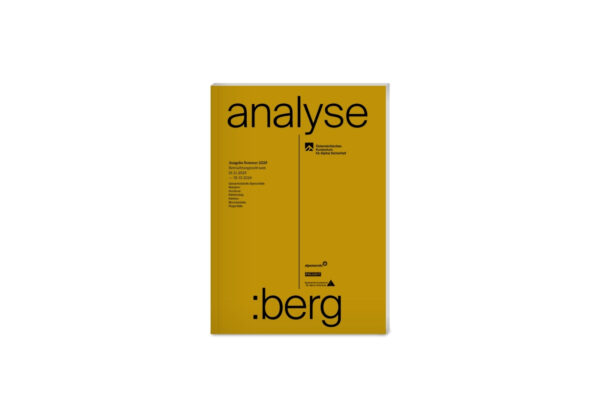Die vom ÖKAS angebotene Fortbildung für Alpinsachverständige richtet sich an die Sachverständigen der Fachgruppen 05,01 und 09,35, die Landesgerichte Feldkirch und Salzburg, die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die OLG Innsbruck und Linz. Ebenso auch an unsere SV Kollegen in Bayern, der Schweiz und Südtirol. Die Fortbildung 2025 fand in der Wallnerkaserne in Saalfelden auf Einladung von Kdo. GebKpfZ. Obst. Jörg Rodewald und unter der Organisation von Franz Deisenberger, Leiter ArG Alpinsachverständige, statt.
Im Anschluss finden Sie die Zusammenfassung aller Beiträge zum Nachlesen. Diese geben einen Einblick über die Themen der Fortbildung, das Lesen dieser ersetzt aber nicht die Teilnahme an der Veranstaltung, für die ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt wird.
Übersicht
- Canyoningunfall Starzlachklamm
- Tödlicher Unfall in der österreichischen Berg- und Skiführerausbildung
- Partnercheck beim Sportklettern
- Klimawandel – Auswirkungen auf die Kryosphäre im Hochgebirge
- Häufung von Alpinunfällen im Kontext Klimawandel und die Beurteilung im gerichtlichen Verfahren
- Herausforderungen der Eisatzleitung Bergrettung aus juristischer Sicht
- Lawinenunfall beim Graben von Schneehöhlen, Unfall im Zuge militärischer Ausbildung
Canyoningunfall Starzlachklamm, Sonthofen im Allgäu, 03.09.2022
aus Sicht
1. der Alpinpolizei
2. des Sachverständigen
3. der Staatsanwaltschaft
Am 3. September 2022 ereignete sich ein Canyoningunfall in der Starzlachklamm im Allgäu. Durch einen plötzlichen Wasseranstieg in Folge eines Gewitters mit Starkniederschlag wurden insgesamt 27 Personen mitgerissen. Zu beklagen waren drei Schwerverletzte und ein Todesopfer.
Obwohl es sich dabei nicht um den ersten Unfall in besagter Klamm handelt, zeigt dieser Unfall einige Auffälligkeiten. Der Unfall wird im Folgenden aus der Sicht der Alpinpolizei, des Sachverständigen und der Staatsanwaltschaft beleuchtet.
1. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht der Alpinpolizei
Gerold Blank
Berg- und Canyoningführer, Alpinpolizei Bayern
FAKTEN ZUR STARZLACHKLAMM, BEGRIFFLICHKEITEN
Die Starzlachklamm befindet sich im Oberallgäu in der Nähe von Sonthofen. Der Talort ist Winkel, wo sich auch der allgemeine Parkplatz befindet. Die Örtlichkeit ist etwas unübersichtlich, denn hier treffen sich alle Besucher, Wanderer und auch Canyoningäste, die hier ihr Einführungsgespräch haben. Um zum Einstieg der Klamm zu gelangen, kann man entweder einen Forstweg oder einen Wanderweg nutzen. Durch die Klamm führt eine kostenpflichtige Steiganlage.
Weiter oben an der Starzlach befindet sich eine 22 Meter hohe Hochwasserverbauung, die sogenannte Ofenwaldsperre. Das Einzugsgebiet der Starzlach umfasst fast 20 Quadratkilometer. Hier befinden sich zwei online abrufbare Messstände – zum einen ein Niederschlagsmesser und zum anderen ein Pegelmessstand, wobei dieser für die Canyoningtour nicht relevant ist, da dieser erst ab 2,5 Kubikmeter Durchlauf anschlägt.
Mit einer Schwierigkeit zwischen 2 und 3 auf der 6-stelligen Skala handelt es sich um eine klassische Einsteigertour. Vom Einstieg bis zur Abschlussrutsche beim Schleierwasserfall werden 75 Höhenmeter überwunden. Die Begehungszeit beträgt rund 1,5 Stunden. Die Tour wurde in der Unfallsaison bei Pegelständen zwischen 98 und 112 cm geführt, das entspricht rund 0,2 bis 0,4 Kubikmeter Durchfluss. Es gibt aber keinen festen Wert, der unter den Führern festgemacht wäre.
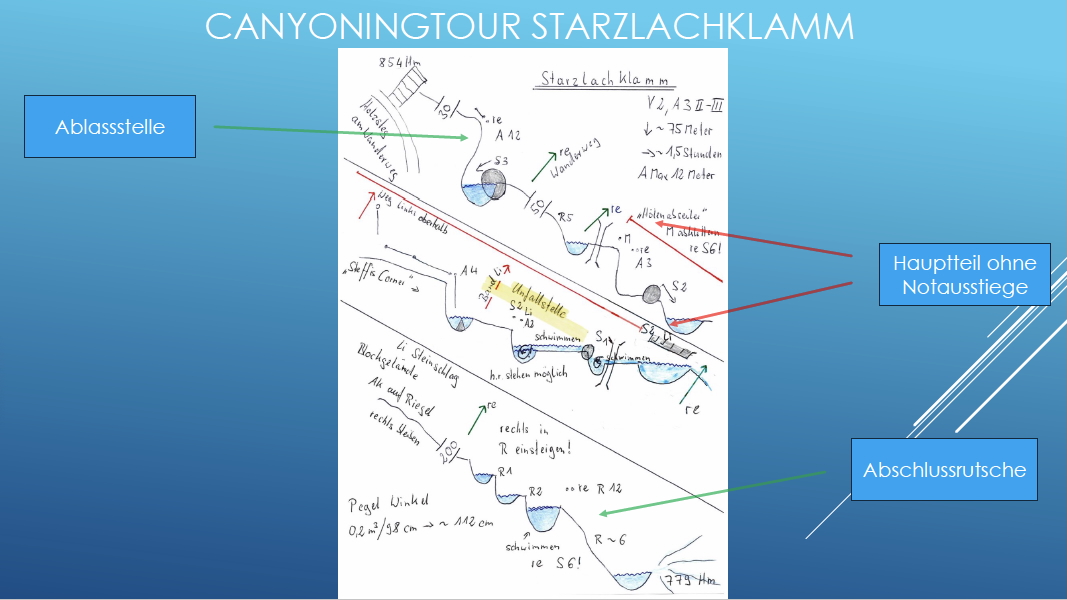
↑ Topo der Canyoningtour Starzlachklamm.
Quelle: Aus der Präsentation von Gerold Blank.
UNFALLÖRTLICHKEIT
Der Unfall ereignete sich kurz nach der letzten Notausstiegsmöglichkeit und im Bereich einer markanten Engstelle der Klamm, bei welcher die Gäste üblicherweise abgelassen werden. Der Polizei lag ein Video einer Zeugin vor, welches zum ungefähren Unfallzeitpunkt gefertigt wurde, auf dem der Wasseranstieg deutlich zu sehen war. Außerdem sah man am Video bzw. auf den Bildern, dass sich zum Umfallzeitpunkt zwei Gruppen (unterschiedliche Farbe der Helme) am Standort befanden. Die Personen standen in dem Bereich teilweise ungesichert und wurden durch die Kraft des Wassers mitgerissen. Teilweise konnten sich die Personen am Seilgeländer festhalten, die meisten aber nicht. Der Wanderweg durch die Klamm befindet sich an dieser Stelle nur ein paar Meter oberhalb, aber es sind keine Notausstiegsmöglichkeiten eingerichtet, was es den Guides deutlich erschwert, hier handlungsfähig zu sein.
Gemäß den Zeugenaussagen kann davon ausgegangen werden, dass die tödlich verunglückte Person gerade abgelassen wurde und dann am offenen Seilende im seichten Wasser im Bereich einer kurzen Gehstrecke stand, als der Wasserschwall kam und sie mitriss. Die Frau wurde über die nächsten Stufen hinunter gespült. Im Bereich eines großen Kolkes mit Kehrwasser befinden sich mehrere alte Haken. Daran gelang es einer Person, sich zu sichern. Weitere Personen konnten sich dazu hängen. In Summe hingen hier acht Personen und warteten auf die Rettung.
Die verunfallte Person schaffte es nicht, sich hier dazu zuhängen. Ein Guide schwamm ihr nach und wurde selbst schwer verletzt.
BERGUNG DER VERLETZEN UND LETZTLICH DER VERUNGLÜCKTEN
Die in Not geratenen Personen konnten schließlich von der Bergwacht gerettet werden. Das talwärts gelegene Flussbett wurde mit Hilfe der Feuerwehr und mittels Hubschrauber abgesucht, am selben Tag konnte aber niemand mehr gefunden werden. Am Parkplatz wurde ein Sammelpunkt eingerichtet, um die Mitglieder der Gruppen zuzuordnen und zu betreuen und die Einsätze zu koordinieren. Dabei stellte sich heraus, dass eine Frau fehlte. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen.
Am nächsten Tag wurde die Suche bei bereits deutlich vermindertem Wasserstand auch mittels Drohnen wieder aufgenommen. Der Leichnam wurde gefunden und geborgen.
POLIZEILICHE MASSNAHMEN UND FESTSTELLUNGEN
Die Aufarbeitung des Falles erfolgte durch die Kriminalpolizei Kempten unter Zuarbeit der alpinen Einsatzleitung der Polizei Allgäu.
Die Details zur polizeilichen Ermittlung in Bezug auf einzelne Personen werden hier nicht veröffentlicht.
Einzig zur Vorhersehbarkeit des Wärmegewitters kann gesagt werden, dass der örtliche Wetterbericht für den Nachmittag Wärmegewitter prognostiziert hatte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes (mehr dazu unter Punkt: „Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft“). Zudem konnte eine Verklausung sowohl im Bachlauf selbst als auch im Durchlass der Ofenwaldsperre ausgeschlossen werden.
Festgehalten werden kann außerdem, dass für die Begehung der Klamm firmenübergreifende festgelegte Zeitslots sowohl für Vormittags- als auch Nachmittagstouren vergeben werden, was das Abwarten eines Regenschauers kaum zulässt. Die für alle Firmen geltenden Regelungen zur Gruppengröße pro Führungstour in der Starzlachklamm besagt, dass ein Guide mit max. 7 Personen gehen darf, ab 8 Personen sind 2 Guides vorgesehen. Die max. Gruppengröße beträgt 14 Personen. Für weitere Details zu Canyoningunfällen wurde von der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter bestellt – in diesem Fall Franz Deisenberger, dessen Ansichten im Teil „Der Unfall aus Sicht des Sachverständigen“ dargestellt sind.
2. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht des Sachverständigen
Franz Deisenberger
Berg- und Skiführer, UIAGM Canyoningführer, Skischulleiter Vorsitzender ArG „Alpin – SV“ Österreich
GUTACHTENSAUFTRAG
Der Gutachtensauftrag erging per e-mail vom 06.03.2023 von OStA Dr. Hanspeter ZWENG StA Kempten/Allgäu an Franz Deisenberger, der diesen annahm. Darin enthalten war folgender Satz, aus dem sich die Fragestellungen ergeben:
„Um den Fall abzuschließen, bedarf es eines Sachverständigengutachtens, das sich insbesondere zu der Frage äußert, ob die Führer den Einstieg in die Klamm hätten unterlassen müssen, soweit angesichts der Wetterprognosen und des einsetzenden Regens der Pegelanstieg vorhersehbar gewesen wäre oder wenigstens auf die Gefahren hinweisen hätten müssen, damit die Teilnehmer eigenverantwortlich über die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können.“

↑ Blick in die Starzlachklamm.
Quelle: Aus der Präsentation von Franz Deisenberger.
Bearbeitung des Gutachtensauftrags
Um dem Auftrag gerecht zu werden, wählte Franz Deisenberger in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Bayern, AEG-Canyoning, folgende Vorgangsweise:
- Ortsaugenschein mit den zuständigen Beamten (AEG – Canyoninggruppe) zur Ergänzung der bereits bestehenden Erhebungsergebnisse
- Feststellungen zur „Vorwarnzeit“ der Canyoninggruppen vor dem Wasserschwall
- Begehung des gesamten Bachbettes mit Höhen- u. Längenaufzeichnung von der Ofenwaldsperre (NS Messer + Pegel) bis zum Ortsteil Winkel (Brücke Pegel)
- Drohnenbefliegung des Bachbettes zur Kontrolle der Messergebnisse
- Zusammenarbeit/Diskussion der Ergebnisse mit ehem. Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes Bayern bzw. des hydrologischen Dienstes Sbg. insb. Abflussgeschwindigkeiten und Abflussmengen betreffend
- Erstellung eines Weg–Zeit–Diagrammes bzw. Zusammenschau der zeitlichen Abfolge des Unfalles in Bezug auf die Unwetterwarnung der Wetterprognose, der aktuellen Pegelstände in der Ofenwaldsperre, dem Wasserschwall Starzlach beim Einstieg der Gruppen und dem Wettercheck in der Base
- Check der Telefonverbindungen, die ergab, dass diese nahezu an jeder Stelle (auch im Bachbett) zwischen Beginn der Tour und dem letzten Notausstieg (vor der Brücke) gegeben ist.
ABLAUF DES GESCHEHENS
Ab 13.58 Uhr war die Unwetterwarnung des DWD (Deutscher Wetterdienst) für den Bereich Sonthofen öffentlich. Egal, welchen Wetterdienst man sich ansieht, ob meteoblue oder meteoSwiss, Unwetterwarnungen werden immer auf der ersten Seite prominent angeführt. In diesem Fall war eine solche Warnung für ganz Allgäu von 14.16 Uhr bis ca. 15.00 Uhr ausgegeben.
Um etwa 14.00 Uhr trafen beide Canyoning-Gruppen (10 + 2 bzw. 14 + 2) – gesamt 28 Personen – am Parkplatz zusammen, wo sich auch noch andere Gruppen befanden, und zogen die Anzüge an.
Es erfolgte der Aufstieg der Gruppen über den Wanderweg und eine Registrierung am Kiosk/Kassenhäuschen (die Führer tragen die Anzahl der Teilnehmer und die genauen Uhrzeiten in ein Buch ein). Während des Aufstiegs regnete es stark, es „gewitterte“. Ein Teilnehmer brach aufgrund der Wettersituation von sich aus die Tour ab und blieb am Wanderweg. Insgesamt brach an diesem Tag nur eine Firma mit ihrer Gruppe die Tour ab.
Um ca. 14.40 Uhr waren beide Gruppen am Einstieg und es erfolgte eine kurze Einweisung, die üblicherweise zwischen 10 und 15 min dauert.
Die 1. betroffene Gruppe war bereits ca. 20 min voraus, um ihr Zeitfenster (ca. alle halben Stunden bricht eine Gruppe vom Kassenhäuschen aus auf) zu nutzen.
Wettersituation/Niederschlag – Pegelstände zeitl. Ablauf Canyoningtour
Eine „Abflusswelle“, die von der Ofenwaldsperre kommt oder sich von dort her Richtung Klamm aufgrund von Niederschlag, Seitengerinne und Oberflächenwasser … (weiter) aufbaut, benötigt für die rund 2,6 km Bachlänge (Gehstrecke) bis zum üblichen Einstieg der Canyoningtour (= ca. 100 m oberhalb der oberen Brücke) knapp 20 min.
Zugrunde gelegt ist dabei eine durchschnittliche Abflussgeschwindigkeit von rechnerisch 2,22 m/sec (Entfernung Pegel Ofenwald – Pegel Winkel gut 4 km + ca. 160 Hm), die mit den Kollegen der Wasserwirtschaft berechnet wurde. Die automatische Pegelmessung in der Ofenwaldsperre kann jeder öffentlich über die Seite des Wasserwirtschaftsamtes einsehen.
In diesem Fall hat die Messstation einen (Stark-)Niederschlag im Einzugsgebiet bzw. Umfeld der Ofenwaldsperre ab ca. 14.30 bis 15.00 Uhr von aufsummiert 12,6 mm angezeigt. Der (See-)Pegelanstieg Ofenwaldsperre konnte ab ca. 15.00 bis 15.30 Uhr (ges. 19 cm) – Verzögerung etwa 0,5 bis 1 Stunde – beobachtet werden. Der immer stärker werdende Abfluss erzeugte schließlich eine „Abflusswelle“, die durch weiteren Niederschlag, Seitengerinne, Oberflächenwasser … bis zum Einstieg der Canyoninggruppen oberhalb der Klamm höchstwahrscheinlich noch verstärkt wurde.
Bzgl. des zeitlichen Ablaufes des Niederschlagsereignisses vom 03.09.2022 wird dazu im Gutachten des Deutschen Wetterdienstes u. a. ausgeführt: „Die Niederschläge intensivierten sich nach den Radarbildern im Bereich der Klamm besonders ab etwa 14:20/14:30 Uhr und damit etwa zu der Zeit, wo die Zeugin D. (jene Person, die im Büro die Wetterdaten checkte) angegeben hat, nochmals Wetter und Pegelstände abgefragt zu haben“. Dazu liegt ein Screenshot ihres Mobiltelefons vor, der die Seite von meteoSwiss zeigt. Allerdings dürfte sie das Regenradar nicht beachtet haben, obwohl der Deutsche Wetterdienst eine Starkregenwarnung herausgegeben hat.
FESTSTELLUNGEN
Feststellung 1
Aus den oben genannten Fakten und Tatsachen und der zeitlichen Abfolge der Tourenvorbereitung bzw. der Tour selbst, ergibt sich die „Vorwarnzeit“ für die beiden Canyoninggruppen „C. …“ und „S. … – A“.
Die „C. …“ Gruppe (14 TN + 2 Guides) war vor der Gruppe „S. … – A“ (9 TN + 2 Guides) unterwegs. Nach dem Einweisungsgespräch, das üblicherweise etwa 10 bis 15 min dauert, war die „S. … – A“ Gruppe gegen 15.00 Uhr an der ersten Abseilstelle. Zu dieser Zeit befand sich der letzte Teilnehmer der „C. …“ Gruppe in Sichtweite zu ihnen. Es ist davon auszugehen, dass die Gruppe „C. …“ ca. 15 bis 20 min vor der Gruppe „S. … – A“ in die Tour einstieg.
Um ca. 15.20 Uhr befand sich die „S. … –A“ Gruppe vor der ersten Brücke, also im Bereich des letzten Notausstieges unmittelbar vor der Engstelle. Die „Abflusswelle“ war zu diesem Zeitpunkt etwa 1,3 km oberhalb, also auf der Hälfte der Strecke Ofenwaldsperre–Einstieg. Der zeitliche Abstand zur Gruppe „S. … –A“ betrug dabei rund 10 min (unter Zugrundelegung der rechnerischen Abflussgeschwindigkeit von 2,22 m/sec). Die Gruppe „C. …“ dürfte sich daher zwischen 15.00 und 15.10 Uhr im Bereich der letzten Notausstiegsmöglichkeit (vor der ersten Brücke) befunden haben.
In diesem Zeitraum verstärkte sich – aufgrund des vorangegangenen Starkniederschlages im Umfeld der Ofenwaldsperre und des (See-)Pegelanstieges – der Abfluss deutlich und es kam zum Aufbau der „Abflusswelle“ etwa 2,5 – 2,7 km oder etwa 15 bis 20 min oberhalb der „C. …“ Gruppe.
Die 14 Teilnehmer der „C. …“ Gruppe waren – bereits vorher und in der Folge – (etwas) langsamer als die „S. … –A“ Gruppe mit 9 Teilnehmern unterwegs, was leicht durch z. B. die 1. Abseilstelle erklärbar (Stichwort: größere Gruppe braucht mehr Zeit ) ist.
Feststellung 2
Die Gruppe „C. … “ dürfte zwischen 15.00 und 15.10 Uhr im Bereich des letzten Notausstieges (Bereich der oberen Brücke) gewesen sein. Sie war vor der Gruppe „S. … A“ in die Tour eingestiegen. Die Vorwarnzeit vor der „Abflusswelle“ aus Richtung Ofenwaldsperre beträgt etwa 15 bis 20 min.
Die Gruppe „S. … – A“ war etwa um 15.20 Uhr, also ca. 10 min später, beim letzten Notausstieg. Die Vorwarnzeit vor der „Abflusswelle“ aus Richtung Ofenwaldsperre beträgt daher nur knapp 10 min.
Sobald man als Guide entscheidet, in den engen Klammbereich (flussabwärts der oberen Brücke, letzter Notausstieg) weiter zu gehen, besteht für etwa eine Stunde keine Fluchtmöglichkeit mehr aus der Klamm. Nur mit „fremder Hilfe“ – vom Wanderweg aus – wäre es möglich, aus dem Bachbett der Klamm zu gelangen.

↑ Üblicher Wasserstand in der Starzlachklamm und Wasserstand zum Zeitpunkt des Unfalls.
Quelle: Aus der Präsentation von Franz Deisenberger.
BEANTWORTUNG DER FRAGEN AUS DEM GA-AUFTRAG
- War aufgrund der Wetterprognose und des einsetzenden Regens beim Zustieg mit einem derart „massiven“ Anstieg der Starzlach zu rechnen – war der „massive“ Wasseranstieg also vorhersehbar?
Je nachdem welche Informationsgrundlage für die Planung/Durchführung der Canyoningtour herangezogen wird, ist der „massive“ Wasseranstieg einerseits sehr wahrscheinlich – also vorhersehbar – andererseits wenig wahrscheinlich – kaum (nicht) vorhersehbar. Unter Zugrundelegung der Informationen, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Unfalltag, zumindest ab 13.58 Uhr („Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“) für den Bereich Sonthofen kommunizierte, konnte mit einem „massiven Wasseranstieg“ in der Starzlach jedenfalls gerechnet werden.
Unter Zugrundelegung der Aussagen der Zeugin (Mitarbeiterin der Canyoning-Firma), die den privaten „Wetterdienstleister“ meteoblue bzw. den nationalen Schweizer Wetterdienst, meteoSwiss als Informationsbasis nennt, in denen angeblich Starkniederschlag im Umfeld/Einzugsgebiet der Starzlachklamm nicht prognostiziert wurde, war das Ereignis wenig wahrscheinlich bzw. kaum (nicht) vorhersehbar.
Da die Inhalte dieser Wetterabfragen nicht bekannt sind, können diese auch nicht verifiziert werden.
Auffallend ist, dass weder die Unwetterwarnung des DWD – bekannt ab 13.58 Uhr – noch die öffentlich abrufbaren Niederschlags-Daten sowie die (See-)Pegelstände der Ofenwaldsperre (aktualisiert alle 15 min) in die Planung der Nachmittagstouren (z. B. Wettercheck der Zeugin um 14.23 Uhr) einflossen. Und dies betrifft im Prinzip alle kommerziellen Anbieter (mind. 3, wahrscheinlich 5), die sich zwischen ca. 13.00 und 14.00/14.30 Uhr am Parkplatz zur Starzlachklamm eingefunden/getroffen haben bzw. in der Klamm unterwegs waren.
Der private Wetterdienst „meteoblue“ stellt z. B. im Ausland, Unwetterwarnungen von nationalen Wetterdiensten (DWD, GeoSphere Austria, …) üblicherweise gleich auf der Startseite prominent dar. Insofern sind die Angaben der Zeugin (Wetterabfrage 14.23 Uhr) nicht nachvollziehbar. Sie gibt u. a. an: „… es war ein bisschen Regen angesagt. Aber nicht viel Regen und kein Unwetter“.
Warum bei einer derartigen Wetterlage die
(See-)Pegelstände der Ofenwaldsperre u./od.
das Niederschlagsradar nicht abgefragt bzw.
beachtet wurden, ist nicht nachvollziehbar!
- Hätten, aufgrund der Wetterprognose bzw. des einsetzenden Regens während des Zustieges, die Führer es unterlassen müssen in die Starzlachklamm einzusteigen – also die Tour erst gar nicht beginnen dürfen?
Dass am Nachmittag des Unfalltages ganz allgemein mit Gewittern zu rechnen war, darf aufgrund der Prognosen der Vortage (vgl. z. B. ON 258 f) des DWD und der allgemeinen Wetterlage und Informationsmöglichkeiten als bekannt und (bei den in der Starzlachklamm tätigen Canyoninganbietern) vorausgesetzt werden (Stichwort: täglicher Wettercheck).
Schon aufgrund der „Vorwarnung“ durch Regen und Gewittertätigkeit am Parkplatz Winkel und während des Zustieges, hätte am Einstieg bzw. spätestens im Bereich des letzten Notausstieges das aktuelle Wetter- Niederschlagsgeschehen von den Beschuldigten/Guides nochmals geprüft werden müssen. Das wäre insofern ohne größeren zeitlichen Aufwand möglich/zumutbar gewesen, da in diesen Bereichen Handy-/Datenempfang möglich ist.
Bei prognostizierter sowie gegebener gewitterträchtiger Gesamtwetterlage sowie Gewitter und Regen am Parkplatz und am Weg zum Einstieg und einer „Unwetterwarnung“ des DWD für das betreffende Gebiet am Unfalltag, muss der einmalige Wettercheck (für die Nachmittagstour) einer Mitarbeiterin eines kommerziellen Canyoninganbieters als nicht ausreichend für die erforderliche und notwendige Risikominimierung (Stichwort: erhöhte Sorgfaltspflicht bei Gewittergefahr) angesehen werden.
Dies insofern, als ein weiterer (2.) Wettercheck – am Anfang der Tour, der eigenen Canyoninggruppe, also etwa gegen 15.00 Uhr, keinen großen Aufwand in zeitlicher und administrativer Form dargestellt hätte, also leicht möglich/zumutbar gewesen wäre.
Nach diesem neuerlichen Wettercheck
(z. B. Niederschlagsmesser Ofenwaldsperre, NS-Radar meteoblue, …)
etwa gegen 15.00 Uhr, hätten die Beschuldigten
z. B. per Handy aktiv, vom „Büro“ der Canyoningfirma
aus über den starken Niederschlag (z.B. 12,6 l/m2 in 30 min)
an der Ofenwaldsperre informiert/gewarnt werden können.
- Hätten die Führer, z. B. beim Einweisungsgespräch am Einstieg, auf die mögliche Gefahr eines derart „massiven“ Wasseranstieges in der Schlucht hinweisen müssen, damit sich die Teilnehmer eigenverantwortlich für einen Abbruch oder die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können?
Im ggst. Fall müssen beim Einweisungsgespräch (Sicherheitseinweisung) am Einstieg alle wesentlichen Themen, die den Ablauf bzw. dem „Risiko“ einer üblichen Anfänger Canyoningtour entsprechen, besprochen bzw. erklärt werden, um die Teilnehmer auf die bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten.
Ein derartiger plötzlicher und „massiver Wasseranstieg“ (um das ca. 22fache – von ca. 0,12 auf ca. 2,66 m³ – des ursprünglichen Durchflusses), wie es ihn am Unfalltag gegeben hat, ist kein übliches Ereignis bei einer Canyoningtour. Es ist daher auch nicht üblich bei Canyoningtouren – insbesondere für Anfänger – auf die Möglichkeit bzw. die Gefahren derartiger plötzlicher „Wassereinbrüche“ beim Einführungsgespräch hinzuweisen. Im Übrigen kann nicht der Gast entscheiden, ob er weiter geht oder nicht, sondern diese Entscheidung muss immer der Guide treffen.
BESONDERE AUFFÄLLIGKEITEN DIESES UNFALLS
Die kommerziellen Anbieter weisen eine auffällige Ignoranz gegenüber den örtlichen Gegebenheiten und Nichtverwendung naheliegender, recht simpel zu bekommender wesentlicher Infos wie z. B. Niederschlagssituation, DWD Unwetterwarnungen am Unfalltag, Wetterdaten (meteoSwiss, Meteoblue, …), Pegelstände u. Niederschlag-Info Ofenwaldsperre bzw. Echtzeit NS-Radar (meteoblue) auf. Warum diese Daten nicht verwendet oder falsch interpretiert wurden, ist fraglich.
Außerdem ist ein absolutes Festhalten am üblichen zeitlichen Ablauf (Stichwort: 2 Touren am Tag), obwohl bereits einige Tage vor dem Unfall die ansteigende Gewittergefahr bei üblicher Aufmerksamkeit für Guides und Veranstalter leicht erkennbar war, gegeben.
Auffällig ist zudem das „Nicht Beschäftigen“ mit elementaren Grundlagen einer verantwortungsvollen Tourenplanung (Stichwort: Einbeziehung der aktuellen Wettersituation, fehlender zusätzl. Wettercheck von Guides und Büro, …) bei gesteigertem Gewitterrisiko.
Da neben den beiden direkt betroffenen Canyoninggruppen noch mind. zwei bis drei weitere Gruppen vorher (Notausstieg) bzw. nachher (Wanderweg, Parkplatz) unterwegs waren, könnten auch ein gewisser Gruppen- oder Konkurrenzdruck sowie Zeitdruck durch die Vergabe von Zeitslots für jede Gruppe am Kassenhäuschen/Eingang, die 20 bis 30 min Abstände vorgeben, mitgespielt haben.
Aus Sicht des Sachverständigen ist zudem festzuhalten, dass die Beschuldigten das „Aussageverweigerungsrecht“ in Anspruch genommen hatten – eine Vorgehensweise, die durchaus üblich ist, in Österreich bei Outdoorunfällen aber eher selten vorkommt. Als äußerst positiv wird die sehr gute Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei vor Ort sowie mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt genannt.
DISKUSSION
Franz Deisenberger stellt im Anschluss folgende Frage zur Diskussion:
Ist das Risiko, dass bei der Führungstätigkeit im Allgemeinen und bei kommerziellen Canyoning-Touren im Besonderen z. T. eingegangen wird, grundsätzlich zu hoch?
Stichworte:
- wirtschaftlicher Druck/Gewinnmaximierung?
- Einhalten d. organisatorischen Ablaufs (Zeitslots, Kosten, …) – Gruppendruck/Konkurrenzdruck?
- fehlende „geistige“ Flexibilität? („haben wir immer so gemacht“), um auf geänderte Umstände (z.B. häufiger Starkniederschläge, …) zu reagieren
- dies auf Seiten der Guides u. d. kommerziellen Anbieter
3. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht der Staatsanwaltschaft
Hanspeter Zweng
Oberstaatsanwalt als ständiger Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu)
Ziel dieses Beitrages ist weder die abstrakte Darstellung der Rechtslage noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Rechtsproblemen, die aus Anlass der Fallbearbeitung zu behandeln waren. Der Beitrag schildert die verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Vorgaben, die zu beachten waren. Die rechtliche Beurteilung beruht ausschließlich auf der Anwendung des deutschen Strafrechts. Soweit in Ermangelung von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Wien zitiert wurden, sind diese Überlegungen für das deutsche Recht nach Auffassung des Verfassers übertragbar.
DIE ERMITTLUNGEN NACH BEKANNTWERDEN DES UNFALLS
Um 15.31 Uhr am 03.09.2022 ging bei der integrierten Leitstelle Allgäu ein Notruf von einem unbeteiligten Beobachter auf dem Wanderweg der Starzlachklamm ein. Es begann ein Rettungseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Bergwacht, in dessen Verlauf alle in Not geratenen Personen mit Ausnahme einer Person von den Einsatzkräften lebend aus der Klamm gerettet werden. Der vermisste Teilnehmer konnte erst am nächsten Morgen nur noch tot geborgen werden.
Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf der Aufklärung der Umstände, die zum Tod einer Person geführt hatten, die an einer gegen Entgelt geführten Canyoningtour teilgenommen hatte. Außerdem war aufzuklären, wie es dazu kam, dass mehrere Teilnehmer und auch die Guides verletzt wurden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei mit fachlicher Unterstützung von mehreren Polizeibergführern geführt, die selbst ausgebildete Canyoningführer sind. Viele Lichtbilder und Videos und zahlreiche Zeugeneinvernahmen von Personen, die zum Unfallzeitpunkt zugegen waren, wurden von den Ermittlern zusammengetragen. Dadurch gelang es, die Verhältnisse in der Klamm und das Verhalten der Begeher der Klamm so weit zu dokumentieren, dass der später beauftragte Sachverständige für Canyoningunfälle unter Einbeziehung seiner eigenen Ermittlungen vor Ort in der Lage war, alle unfallursächlichen Umstände darzustellen.
Nachdem zum Unfallzeitpunkt Starkregen den Pegel der Starzlach stark anschwellen ließ, beauftragte die Staatsanwaltschaft zunächst einen Meteorologen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wetterlage, den Niederschlagsmengen und den Wetterprognosen für den Unfallzeitpunkt. Der Sachverständige konnte Niederschlagszeitpunkte und Niederschlagsmengen anhand der meteorologischen Beobachtungsstationen, die sich in der Nähe des Unfallortes befanden, genau beschreiben. Hinsichtlich der Wettervorhersage beschränkte sich der Gutachter auf die Wiedergabe der Prognose des Deutschen Wetterdienstes, nachdem eine Fülle von privaten Unternehmen Wetterprognosen publizieren und die bisherigen Ermittlungen kein klares Bild dahingehend erbrachten, welche Informationen die beschuldigten Führer vor Antritt der Tour tatsächlich herangezogen haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Die veröffentlichen Wetterprognosen sind insbesondere über das Internet für jedermann kostenfrei zugänglich. Auch im Bereich der Klamm ist der Handyempfang weitgehend gegeben.
Nach Vorliegen des meteorologischen Gutachtens beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen für Canyoningunfälle mit der Begutachtung des tatsächlichen Ablaufes des Vorfalls, insbesondere zu der Frage, ob die Führer den Einstieg in die Klamm hätten unterlassen müssen, soweit angesichts der Wetterprognosen und des einsetzenden Regens der Pegelanstieg vorhersehbar war oder wenigstens auf die Gefahren hinweisen müssen, damit die Teilnehmer eigenverantwortlich über die Fortsetzung der Tour hätten entscheiden können.
DER BEWEISBARE SACHVERHALT
Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und Vorliegen der beiden Sachverständigengutachten ergab sich folgender, für die strafrechtliche Beurteilung maßgeblicher Sachverhalt:
Die Starzlachklamm gilt als einfache Tour von rund eineinhalb Stunden und einer Gesamtschwierigkeit II – III innerhalb der sechsstufigen Skala. Eine Begehung der Gewässerstrecke im Rahmen eines Augenscheins an einem sonnigen Tag bei niedrigem Wasserstand ergab, dass die begehbaren Abschnitte völlig unproblematisch zu bewältigen sind. Einige Hindernisse können nur durch Springen oder Abseilen bewältigt werden. Die Begehung ist dennoch auch für Ungeübte unter Aufsicht von erfahrenen Personen ohne nennenswerte Gefahr möglich. Es gibt an vielen Stellen leicht erreichbare Ausweichmöglichkeit über den parallel verlaufenden Wanderweg. Für die Benutzung dieses Wanderweges, der wie die Klamm selbst über privates Eigentum verläuft, verlangt der Eigentümer die Bezahlung eines Eintrittsgeldes, auch von den Teilnehmern geführter Canyoningtouren.
Das Einzugsgebiet der Starzlach umfasst ein Gebiet von knapp 20 Quadratkilometern. Am 03.09.2022 lag das Allgäu im Bereich einer flachen Tiefdruckrinne. Am Vormittag wechselten sich zunächst Sonne und Wolken ab, in der feuchtwarmen Luft entwickelten sich am Nachmittag Schauer und Gewitter. Nach einem ersten unergiebigen Schauer im Bereich der Klamm gegen 13:35 Uhr, folgten weitere Niederschläge mit geringer Intensität zwischen 14:00 und 14:10 Uhr. Diese erhöhten sich in den nachfolgenden 10 bis 15 Minuten allmählich auf eine mäßige Intensität. Zwischen etwa 14:25 Uhr und 14:45 Uhr kam es im Einzugsbereich der Starzlach zu einem Starkregenereignis. In diesen 20 Minuten gingen rund 10 bis 15 I/m2 nieder. Bis 14:50 Uhr schwächte sich der Regen allmählich ab, gegen 16:00 Uhr kam es nur noch zu leichten Niederschlägen. An den nächstgelegenen meteorologischen Stationen Ofenwaldsperre und Sonthofen wurden die ersten Niederschläge zwischen 14:00 und 14:10 Uhr erfasst. Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr traten an der Station Ofentalsperre starke Niederschlagsintensitäten mit jeweils mehr als 1,7 l/m2 innerhalb von 10 Minuten auf. Die höchste 60-Minutenmenge mit knapp 23 l/m2 wurde zwischen 14:05 und 15:05 Uhr im Bereich der Klamm ermittelt.
Im Vorhersagetext des DWD für Bayern vom 31.08.2022 wurden für den 03.09.2022 eine am Nachmittag zunehmende Schauer- und Gewitterneigung aufgeführt. Am Vortag des 03.09.2022 wurden Gewitter im Text zur Warnlage aufgenommen. Erwartet wurden früh vereinzelte Gewitter mit Starkregen zunächst in Schwaben, die im Laufe des Samstags auf ganz Bayern übergreifen sollen. Am Tag des Unfalls hatte der DWD gewittrige Niederschläge für den Nachmittag prognostiziert. In der Vorhersage vom Morgen des 03.09.2022 wurden besonders ab der zweiten Tageshälfte verbreitet Schauer sowie einzelne Gewitter mit Starkregen erwartet. Die erste konkrete Warnung vor Gewittern mit Starkregen für den Kreis Oberallgäu erfolgte um 13:58 Uhr mit einer Gültigkeitsdauer bis 15:00 Uhr. Die Warnung wurde um 14:16 Uhr aufgrund hoher erwarteter Böen aktualisiert. Um 14:50 Uhr wurde die Gültigkeit der Warnung bis 16:30 Uhr erweitert und um 15:05 Uhr nochmals wegen Hagel aktualisiert.
Auch der Zustand der Gewässerstrecke zum Unfallzeitpunkt konnte ausreichend aufgeklärt werden. Die anfängliche angestellte Vermutung, eine gebrochene Verklausung könnte Ursache für einen Wasserschwall gewesen sein, konnte nach Überprüfung des Bachlaufs durch die Polizeibeamten ausgeschlossen werden. Auch der Sachverständige schloss dies im Gutachten aus, weil die Veränderung der Pegelstände anders verlaufen wären. Die weiteren Ermittlungen ergaben sonst keine für die Beurteilung des Falles relevanten Besonderheiten der Gewässerstrecke, die Einfluss auf die Beurteilung des Falles hatte. Die Auswertung der Pegelmessdaten durch den Sachverständigen ergab innerhalb von 30 Minuten einen erheblichen Pegelanstieg von 102 cm auf 133 cm, die Durchflussmenge vergrößerte sich unter Berücksichtigung der Fließgeschwindigkeit in den Engstellen um das 22-fache.
Alle eingesetzten Guides verfügten über eine solide Ausbildung, die sie zweifelsfrei in die Lage versetzte, auch eine Gruppe in der Größe, die sie am Unfalltag geführt hatten, sicher durch die Klamm zu geleiten. Der Veranstalter, der für die Führung der Gruppe verantwortlich war, der die verstorbene Person angehört hatte, unterhielt ein Sicherheitskonzept, das für die Starzlachklamm folgenden Warnhinweis erhält: „Wasserschwall: Die Starzlachklamm kann sehr rasant und ohne unmittelbare Vorwarnung ansteigen. Im weiteren Verlauf des Flusses befinden sich mit den Ofenwaldsperren mehrere Geschiebesperren, an denen sich auch Verklausungen anstauen und plötzlich entladen können. Im mittleren Schluchtenteil befinden sich keine Ausweichmöglichkeiten bei plötzlichem Wasserschwall“.
Zum eigentlichen Unfallablauf konnte festgestellt werden, dass zwei Gruppen, geführt von je zwei Führern zweier unterschiedlicher Anbieter ihre Canyoningtour begannen. Eine Gruppe bestand aus 14 Gästen, eine weitere aus 10 Gästen. Beim Einweisungsgespräch am Einstieg wurden die Risiken eines plötzlichen und massiven Wasseranstieges nicht besprochen. Die Gruppen begannen gegen 13:30 Uhr am Parkplatz im Ortsteil Winkel mit der Wanderung zum Einstieg. Bereits während des Zustiegs regnete es, so dass ein Gast wegen der Verhältnisse entschied, nicht weiter mitzugehen.
Beide Gruppen stiegen zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in den Bach ein. Der Sachverständige konnte feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt der Wasserstand am Einstieg etwas höher war als üblich, aber deutlich unterhalb des Grenzwertes, der eine Begehung nicht mehr zulässt. Das Wasser war zu diesem Zeitpunkt klar. Gegen 15:30 Uhr befanden sich beide Gruppen in einem tief eingeschnittenen Klammabschnitt, zu diesem Zeitpunkt war der Pegel des Baches stark angestiegen. Gut erkennbar für alle war die höhere Fließgeschwindigkeit und das stark braun eingetrübte Wasser. Alle Guides kannten die Klamm aus vielen vorherigen Begehungen. Beide Gruppen setzten den Weg trotz des gestiegenen Wasserspiegels in der Klamm fort. Zu diesem Zeitpunkt wäre es problemlos möglich gewesen, die Klamm zu verlassen und auf dem danebenliegenden Wanderweg eine kurze Strecke talwärts zu gehen, um dann wieder in die Klamm einzusteigen. Es wurden auch keine Sicherungsmaßnahmen zugunsten der Gäste ergriffen, die Guides verzichteten auch darauf, zunächst die Lage zu erkunden. Ein weiteres Einweisungsgespräch bezüglich der gestiegenen Risiken, die mit der weiteren Begehung der Klamm verbunden waren, gab es nicht.
In der Engstelle wurden dann 13 Gäste und auch die 4 Guides bis in ein großes Wasserbecken von den Wassermassen mitgerissen und konnten sich erst dort in Sicherheit bringen oder geborgen werden. Drei Gäste und Guides wurden teils schwer verletzt. Eine Person konnte erst am nächsten Tag tot geborgen werden.
DIE STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG DES SACHVERHALTS
- 159 StPO lautet: Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, oder wird der Leichnam eines Unbekannten gefunden, so sind die Polizei- und Gemeindebehörden zur sofortigen Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an das Amtsgericht verpflichtet.
- 160 StPO: Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.
Diese gesetzliche Verpflichtung kann nur so verstanden werden, dass eine umfassende Prüfung stattfinden muss, die alle möglichen Verantwortlichen in den Blick nimmt. Das Todesermittlungsverfahren gem. § 159 StPO ist ein Beweissicherungs- und Vorprüfungsverfahren, hat aber nicht den Verdacht einer konkreten Straftat zum Gegenstand, ist also kein Ermittlungsverfahren i. S. des § 160 StPO (BGH, Beschl. v. 28.3.2018 – 2 ARs 97/18).
Der Grundstückseigentümer der Gewässerstrecke
Die Verkehrssicherungspflicht eines Grundstückseigentümers umfasst die Verpflichtung, alle Benutzer, die von den Verkehrsflächen im Rahmen zweckentsprechender Nutzung Gebrauch machen, vor Gefahren zu schützen, die aus dem Zustand dieser Verkehrsflächen herrühren. Erforderlich sind nur solche Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um die Gefahr von Dritten abzuwenden, also nur solche, die nach den Sicherheitserwartungen des jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, Gefahren von Dritten tunlichst abzuwenden, die bei bestimmungsgemäßer oder bei nicht ganz fernliegender bestimmungswidriger Benutzung drohen. Der Eintritt wird aber nur für die Benutzung des Weges bezahlt. Scheidet damit die Haftung für den Rückweg über die Gewässerfläche aus? Vorkehrungen zur Abwendung von Gefahren bei Begehung der Wasserfläche, insbesondere gegen die Gefahren, die mit einem schnell ansteigenden Wasserpegel verbunden sind, wurden bislang nicht als notwendig erachtet. Daher gab es keine Anhaltspunkte für ein Verschulden des Grundstückseigentümers.
Die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden
Nach Art. 6 des bayerischen Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) haben die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration als Sicherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten. Als Gefahr ist eine Sachlage zu verstehen, nach der nach allgemeiner Lebenserfahrung und ungehindertem Fortgang das Eintreten einer konkreten Gefahr für Schutzgüter zu erwarten ist. Bislang sind insoweit keine gerichtlichen Entscheidungen bekannt geworden, wonach die Sicherheitsbehörden verpflichtet wären, Gewässerstrecken, die für das Canyoning genutzt werden, in vergleichbarer Weise wie von Lawinen bedrohte öffentliche Straßen oder Skipisten zu überwachen und gegebenenfalls rechtzeitig bei drohenden Naturgefahren zu sperren. Jedenfalls so lange eine Verantwortlichkeit für ein Einschreiten der Sicherheitsbehörden nicht gesetzlich oder durch eine gefestigte obergerichtlicher Rechtsprechung festgelegt wurde, kommt eine strafrechtliche Verfolgung von Behördenmitarbeitern nicht in Betracht.
Der Veranstalter
Alle Teilnehmer bezahlen eine Gebühr als Teil eines mit dem Veranstalters geschlossenen Vertrages, für die als Gegenleistung die Führung durch die Klamm organisiert wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) definiert den Veranstalter und damit Vertragspartei als denjenigen, der in organisatorischer und finanzieller Hinsicht für die Veranstaltung verantwortlich ist. Wird die Pflicht auf einen Dritten delegiert, so wird der Dritte für den Gefahrenbereich nach allgemeinen Deliktsgrundsätzen verantwortlich. Der Veranstalter hat bei Ausübung seines Gewerbes grundsätzlich diejenigen Sicherungsvorkehrungen zu treffen, die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter Angehöriger der jeweiligen Berufsgruppe für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schaden zu bewahren, und die ihm den Umständen nach zuzumuten sind (vgl. BGH, NJW 2000, 1188). Es gehört zu den Grundpflichten des Veranstalters, die Personen, deren er sich zur Ausführung seiner vertraglichen Pflichten bedient, hinsichtlich ihrer Eignung und Zuverlässigkeit sorgfältig auszuwählen (vgl. BGHZ 100, 185, 189). Er muss sie regelmäßig den jeweiligen Umständen entsprechend überwachen (BGHZ 103, 298). Beide Veranstalter hatten hinreichend ausgebildete Fachkräfte zur Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtung eingesetzt. Anhaltspunkte für die Verletzung der Überwachungspflichten gab es nicht. Zwar besteht in der Klamm weitgehend ununterbrochen die Möglichkeit, über Handy zu kommunizieren. Die Veranstalter durften sich aber auch unter den gegebenen Umständen auf die Einschätzung der von ihm eingesetzten Fachkräfte verlassen, nachdem es bislang insoweit zu keinen Unfällen in vergleichbaren Situationen gekommen ist. Somit ist den Veranstaltern kein strafrechtlicher Vorwurf zu machen.
Die einzelnen Teilnehmer
Bislang war das Rechtsverhältnis von Privatpersonen untereinander bei geführten Canyoningtouren noch nicht Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Anders beim Klettern: Klettern Privatpersonen miteinander, scheiden vertragliche Ansprüche regelmäßig aus, dazu müsste nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB per Vertrag eine Sonderverbindung zwischen den Beteiligten geschaffen werden. Auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete explizite Willenserklärungen werden aber beim rein privaten gemeinsamen Klettern und auch bei einer geführten Tour in der Regel innerhalb der geführten Teilnehmer aber nicht vorliegen. Hier kann man wegen des Fehlens des entsprechenden Rechtsbindungswillens auch nicht vom Vorliegen eines Gefälligkeitsverhältnisses mit rechtsgeschäftlichem Charakter ausgehen. So stellt beispielsweise das Sichern beim Klettern eine reine Gefälligkeit dar. Damit gibt es zwischen den Teilnehmern grundsätzlich auch keine Garantenstellung aus vertraglichen Absprachen. Anhaltspunkte, dass hier im Einzelfall doch Absprachen stattgefunden hätten, ergaben sich nicht. Es gab auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Teilnehmer, die nach ihren Angaben keine nennenswerte Erfahrung im Bereich des Canyoning hatten, über ein überlegenes Erfahrungswissen verfügt hätten, das sie in die Lage versetzt hätte, Einfluss auf die Entscheidung der Führer zu nehmen.
Die Führer
Selbst ein Bergführer „aus Gefälligkeit“ haftet einem unerfahrenen Begleiter, den er auf eine Bergtour mitnimmt, bei einem Unfall, wenn er diesem (erst später auftretende) Gefahren und Schwierigkeiten verschweigt oder wenn er ihn zu einer für diesen schwierigen Bergtour bzw. zu einem schwierigen Abstieg dadurch, dass er deren Gefährlichkeit verniedlicht oder gar bestreitet, überredet. Eine Haftung des Führers „aus Gefälligkeit“ kann auch dadurch begründet sein, dass er ihm zumutbare Sicherheitsvorkehrungen (hier: Unterlassen der Seilsicherung eines unerfahrenen Begleiters bei dem Überqueren eines mittelsteilen Schneefeldes) nicht trifft … Die Frage, welche Sicherungsmaßnahmen im Einzelfall zu treffen sind und welche Gefahr zu beachten ist, kann bei der Vielfalt der Möglichkeiten nicht generell beantwortet werden. … Gewiss kann auch dem besten Bergsteiger bei außergewöhnlichen Verhältnissen ein Fehler unterlaufen, doch ist die objektive Sorgfaltswidrigkeit danach zu beurteilen, wie sich eingewissenhafter Bergführer oder ein durchschnittlich pflichtbewusster Bergsteiger in der jeweiligen Situation verhalten hätte (Oberster Gerichtshof Wien, Urteil vom 30.10.1998, Aktenzeichen: 1 Ob 293/98i).
Hier handelt es sich um eine geführte Canyoningtour, für die die Teilnehmer Entgelt zahlen und diese Dienstleistung gerade deshalb in Anspruch nehmen, um mögliche Risiken und Probleme zu vermeiden. Durch das meteorologische Gutachten und die Zeugenaussagen stand fest, dass es bereits beim Aufstieg durch die Klamm regnete. Dies führte zu der vom Sachverständigen dargestellten Zunahme des Pegels der Starzlach. Den Ausführungen des Sachverständigen ist die Erkenntnis zu verdanken, dass dieser Umstand, dem die Canyoningführer bis zum Betreten der Engstelle der Klamm, in der sie dann verunglückten, offenbar wenig Bedeutung beimaßen, strafrechtlich irrelevant ist. Durch die Ausführung des Sachverständigen steht insoweit fest, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, rechtzeitig auf den Weg auszuweichen. Soweit also bis zu diesem Zeitpunkt ein Verschulden der Führer gesehen werden könnte, war dieses mögliche Fehlverhalten nicht ursächlich für den Unfall.
Damit war klar, dass ausschließlich die Entscheidung der Guides, weiterzugehen, ursächlich für die Verletzungen der Teilnehmer war. Im Detail ließ sich nicht klären, ob die Teilnehmer durch Straucheln, Stolpern oder die bloße Einwirkung der Wasserkraft abgetrieben wurden. Für die Verantwortlichkeit der Führer ist das aber unerheblich. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass den Führern ein Zeitfenster von ca. 12 – 13 Minuten vor dem Unfall verblieb, so dass ein Notausstieg bei zutreffender Einschätzung der Lage möglich gewesen wäre. Der Gutachter führt dazu weiter aus: „Sobald man als Guide entschieden hat, in den engen Klammbereich flussabwärts der oberen Brücke nach dem letzten Notausstieg weiterzugehen, hat man für etwa 1 Stunde keine Fluchtmöglichkeit mehr aus der Klamm“.
Fahrlässig im Sinne der §§ 222, 229 StGB handelt ein Täter, der eine objektive Pflichtverletzung begeht, sofern er diese nach seinen subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten vermeiden konnte, wenn die Pflichtverletzung objektiv und subjektiv vorhersehbar den Erfolg herbeigeführt hat. Die Einzelheiten des durch das pflichtwidrige Verhalten in Gang gesetzten Kausalverlaufs brauchen nicht vorhersehbar zu sein (vgl. BGH NJW 2004, 2458). Zweifelsfrei haben die Führer bei ihrer Prognoseentscheidung, ob es zu diesem gegebenen Zeitpunkt noch gefahrlos möglich war, die Engstellen der Klamm zu durchschreiten, die gegebenen Verhältnisse falsch eingeschätzt. Bereits der Umstand, dass sie selbst und so viele Teilnehmer abgetrieben wurden dokumentiert, dass sie die Kraft des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Wasserdrucks auf den menschlichen Körper verkannt haben. Es wäre möglich gewesen, die Klamm vorher zu verlassen und auf dem Wanderweg weiterzugehen. Durch Einsatz von Sicherungsmitteln hätten die Folgen des Unglücks vermindert werden können. Die Erkundung der augenblicklichen Verhältnisse durch einen der Führer hätte mit Sicherheit auch Aufschluss über die Risiken der Fortsetzung der Tour gegeben. Somit sind die Führer für die innerhalb ihrer Gruppe entstandenen Verletzungen verantwortlich. Nachdem es keine vertraglichen Beziehungen mit der in jeweils anderen Gruppen gab, haften die Führer nur für die Verletzungen der Teilnehmer, für die sie verantwortlich waren.
Hätten die Führer beim Einweisungsgespräch auf die möglichen Gefahren eines massiven Wasseranstieges und die damit verbundenen Risiken hinweisen müssen, damit sich die Teilnehmer eigenverantwortlich für einen Abbruch oder die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können? Die eigenverantwortlich gewollte und verwirklichte Selbstgefährdungen ist nicht strafbar, wenn das mit der Gefährdung bewusst eingegangene Risiko sich realisiert. Wer eine solche Selbstgefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert, macht sich nicht wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts strafbar (BGH, NJW 1984, 1469). Die gebotene Aufklärung muss den Teilnehmer in die Lage versetzen, die Sicherheitsrisiken ausreichend und umfänglich abzuschätzen. Die Aufklärungspflicht ist demnach umso strenger, je gefährlicher eine Sportart ist und je weniger damit zu rechnen ist, dass sich der Teilnehmer der Gefahrenlage bewusst ist. Pflichten im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten dürfen aber nicht überspannt werden, weil sportliche Aktivitäten grundsätzlich gefördert und nicht unmöglich gemacht werden sollen (OGH, 22.04.2022, 8 Ob 15/22x, die Entscheidung betrifft eine geführte Canyoningtour). Die Strafbarkeit beginnt erst dort, wo der sich Beteiligende kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser erfasst als der sich Gefährdende (AG Laufen, 06.03.2006, 260 Js 27482/05 veröffentlicht bei JURIS).
Der Sachverständige führt in seinem Gutachten dazu aus, dass üblicherweise beim Einweisungsgespräch alle wesentlichen Themen zum Ablauf einer Canyoningtour besprochen werden, um die Teilnehmer auf die bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten. Ein plötzlicher und massiver Wasseranstieg, wie es ihn am Unfalltag gegeben hat, ist kein übliches Ereignis bei einer Canyoningtour. Es ist aber nicht üblich, Anfänger auf die Gefahren derartiger Wassereinbrüche hinzuweisen.
Die Guides haben die Teilnehmer über diese Risiken nicht aufgeklärt, damit sind ihnen alle eingetretenen Verletzungsfolgen zuzurechnen. Nachdem alle Geiz eine eigene Ausbildung und eine Erfahrungen bei der Begehung der Klamm gesammelt hatten, gab es keine Anhaltspunkte dafür anzunehmen, dass einer der Guides für das Wohlergehen der anderen verantwortlich gewesen wäre. Insofern hatte jeder der Führer es in der Hand, die Unternehmung abzubrechen.
DER AUSGANG DES STRAFVERFAHRENS
Im Zuständigkeitsbezirk der Staatsanwaltschaft Kempten gibt es jedes Jahr eine ganze Reihe von Unfällen im alpinen Bereich. Allein die Tatsache, dass die Ermittlungen ergeben, dass eine Person schuldhaft eine Körperverletzung oder den Tod eines anderen verursacht hat, führt noch nicht zwingend zur Anklageerhebung. Bei fahrlässigen Körperverletzungen, in denen kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, wird meist keine Anklage erhoben, insbesondere bei geringfügigen Verletzungen. Dies gilt bei Verkehrs- oder Sportunfällen gleichermaßen.
In den Fällen, in denen Todesopfer zu beklagen sind, findet grundsätzlich immer eine Strafverfolgung statt. Der Gesetzgeber hat aber in den Fällen, in denen das Verschulden der Beschuldigten nicht allzu schwer wiegt, die Möglichkeit eröffnet, gegen Erfüllung von Auflagen das Verfahren einzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sicherlich keiner der eingesetzten Führer bewusst die Gesundheit und das Leben der Teilnehmer leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat. Es ist vielmehr anzunehmen, dass sie davon ausgingen, die Situation noch beherrschen zu können. Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass gegen die Führer, die nur für Körperverletzungen von Teilnehmern verantwortlich zu machen waren, keine Strafverfolgung stattfand.
Das Verfahren gegen die beiden Führer,
die für den Tod des Teilnehmers verantwortlich waren,
wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage des § 153a StPO eingestellt.

↑ Befundaufnahme vor Ort. Foto: Walter Siebert
Tödlicher Unfall in der österreichischen Berg- u. Skiführerausbildung
Gibt es Unfälle, aus denen man nichts lernen kann?
Walter Siebert
SV Wien
Im Rahmen einer Bergführerausbildung am Großen Geiger in der Venedigergruppe verunglückte ein Aspirant tödlich. Walter Siebert bekam den Auftrag, ein Gutachten zum möglichen Unfallhergang zu erstellen.
DER GUTACHTENSAUFTRAG UND DIE BEWEISSICHERUNG
Der schriftliche Auftrag beinhaltete folgende Fragen:
- Ursachen des Absturzes
- Fragen des Fremdverschuldens
- Fehler/Mängel der Führungstechnik
- Bewertung der Ausrüstung
Eine rasche Befundaufnahme vor Ort war in diesem Fall besonders wichtig, da ein Wettersturz zu erwarten war, der viele mögliche Spuren verwischen hätte können.
Walter Siebert wurde mit dem Polizeihubschrauber in die Nähe der Unfallstelle gebracht. Aufgrund der Wetterlage konnte man nur mit einem kurzen Zeitfenster für die Befundaufnahme rechnen. Aus diesem Grund war für Walter Siebert klar, dass er Kompromisse eingehen wird müssen. Jedenfalls wollte er jegliche Spuren und ev. noch vor Ort auffindbares Material sichern und Fotos machen. Dazu ließ er sich am kurzen Seil von einem Bergführer zur Unfallstelle hinaufsichern, um bei dieser Gelegenheit auch zu sehen, wie üblicherweise an einem solchen Grat gesichert wird.
BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN AUS DEM GA-AUFTRAG
Ausrüstung
Die Ausrüstung war in perfektem Zustand und für diese Route bestens geeignet.
Fehler/Mängel der Führungstechnik
Die Führungstechnik war korrekt, sowohl was die Kursmethodik betrifft (der Ausbildner lässt sich als Gast vom Aspiranten führen) als auch was das konkrete Führungsverhalten des Aspiranten betraf: Vor einer Steilstufe legt man das Seil ab, klettert vor und holt den Gast nach.
Fragen des Fremdverschuldens
Ein Fremdverschulden konnte von Walter Siebert nicht festgestellt werden.
Ursachen des Umfalls
Es erschien vorerst völlig unklar, wie es zu diesem Absturz kommen konnte. Die Verhältnisse waren gut, das Wetter war gut, der Aspirant war fit und war dieselbe Route bereits zwei Wochen zuvor bei Tiefschnee gegangen.
Beim letzten Aufschwung lässt der Aspirant seinen „Gast“ warten und beginnt den Aufschwung zu klettern, wobei er den „Gast“ über einen lockeren Stein informiert.
Gemäß der Aussagen des einzigen Augenzeugen – dem Ausbildungsleiter/Gast – begann sich der Stein plötzlich zu bewegen. Er sah, wie die Hände des Aspiranten zuerst noch am Fels waren und plötzlich wegglitten. Daraufhin sprang er sofort auf die andere Seite des Grates und versuchte, das Seil zu halten. Nach kurzer, sehr starker Belastung, riss das Seil.
Offen blieben aber dennoch die genauen Ursachen des Absturzes. Diese herauszufinden bedurfte einer detaillierten Analyse: In der vom Augenzeugen beschriebenen Situation und in dem Gelände vor Ort fällt ein durchtrainierter Spezialist nicht herunter, wenn sich ein Stein unter seinen Füßen löst. Die Wand ist dort nicht senkrecht und in so einem Gelände kann man ein Wegrutschen durch Bremsen verhindern.

↑ Die Unfallstelle.
Foto: Walter Siebert
Der wichtigste Hinweisgeber war das Seil. Dieses war sowohl gerissen als auch durch Steinschlag abgeschlagen. Außerdem wurde die Schlinge, die man beim Verkürzen nimmt, aufgeschnitten. Der Riss entsprach einem typischen Scharfkantenriss. Der Ausbildungsleiter sagte zudem aus, dass der Zug so stark war, dass, wäre das Seil nicht gerissen, er mitgerissen worden wäre. Das Seil wurde also offensichtlich über eine scharfe Kante abgeschert.
Die Stelle, die durch Steinschlag abgeschlagen wurde, war ebenfalls eindeutig einer einmaligen Gewalteinwirkung zuzuordnen.
Im Anschluss versuchte Walter Siebert das Seil zusammenzusetzen und die einzelnen Längen herauszumessen.
Einzig plausibler Unfallhergang
Walter Siebert ist sich ziemlich sicher, dass nur ein starker Zug am Seil den Aspiranten aus dem Stand reißen konnte. Hier kommt ein Felsblock in Frage, um den sich das Seil verfangen hat. Allerdings dürfte sich nicht der Block, auf dem der Aspirant stand, im Seil verfangen haben, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit lag das Seil auf dem Block. Es dürfte also jener Block, auf dem er stand, ins Rutschen gekommen sein und nachkommende – auch große – Steine müssen sich im Seil verheddert haben. Durch Augenzeugen wurden auch mehrere Felsblöcke beschrieben, die hinunter fielen.
Daher war wohl nicht der Block,
auf dem der Aspirant stand unfallursächlich,
sondern ein nachrutschender Block,
der das Seil nach unten riss.
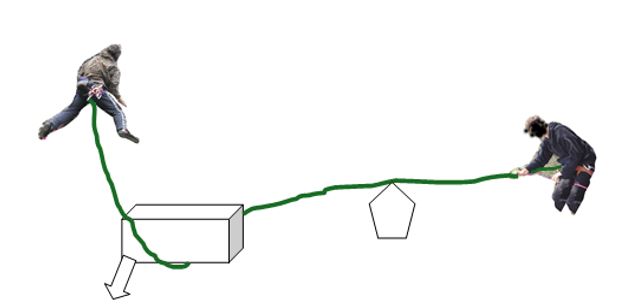
↑ Die mögliche Unfallursache.
Grafik: Walter Siebert
WAS KANN MAN AUS DEM UNFALL LERNEN?
Unmittelbar aus diesem Unfall kann man vermutlich nichts lernen, da keine offensichtlichen Fehler gemacht wurden. Der Job ist grundsätzlich gefährlich und das muss man akzeptieren.
Dennoch hatte der Unfall eine positive Wirkung: Er war Anlass, wieder einmal Gespräche über das Risikomanagement in der Bergführerausbildung zu führen und dieses zu verbessern.
Persönliches Learning für den Sachverständigen
- Auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht in Nebenschauplätzen verlieren. Augenzeugen-Berichte sortieren, was kann stimmen, was nicht.
- Jegliche persönliche Betroffenheit muss man wegschalten können.
- Gut vorbereitet sein. Ausrüstung sollte griffbereit sein.
- Mitnahme einer ultraleichten Notfallausrüstung.

Absturz auf den Boden – Partnercheck erfolgt.
Kann man einen falschen Achternkoten übersehen?
Walter Siebert
SV Wien
UNFALLBESCHREIBUNG
Zu diesem Unfall in einer Kletterhalle mit Absturz auf den Boden, ist Folgendes bekannt:
Zwei befreundete Personen, die sich gut kennen und oft gemeinsam klettern, sind zum Klettern in einer Kletterhalle. Ein Partnercheck wurde durchgeführt. Die verunfallte Person hat sich im Nachstieg ein paar Mal bei einer Stelle hineingesetzt und ist dann abgestürzt. Oben am Umlenker befand sich noch das Seil mit einem „halben“ Achterknoten.
MÖGLICHE URSACHEN
Offenbar hat sich der Achterknoten durch das Hineinsetzen gelöst und ist durchgerutscht. Die Person stürzte ungesichert bis auf den Boden ab. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass der Achterknoten falsch gebunden war und dieser Fehler beim Partnercheck übersehen wurde.
Allerdings löste sich der Knoten nicht beim ersten Hineinsetzen, sondern erst nach einigen Wiederholungen. Zuvor war kein Durchrutschen oder langsames Lösen des Knotens zu bemerken gewesen.

↑ Versuche mit falsch gebundenen Achterknoten im Labor von Walter Siebert.
Fotos: Walter Siebert
KANN EIN ACHTERKNOTEN FALSCH GEBUNDEN WERDEN?
Walter Siebert hat in seinem Labor getestet, ob bzw. wann sich ein falsch gebundener Knoten lösen kann bzw. löst. Im Labor konnte er messen, wie viel Kraft notwendig ist, um den Knoten aufzuziehen. Meistens war es allerdings so, dass sich der Knoten sehr fest zuzog. Erst nach vielen Versuchen ist es Walter Siebert dann aber doch gelungen, einen Knoten und die entsprechende Belastung zu finden, die tatsächlich zu einem Durchrutschen führt – und zwar erst nach mehrmaligem Hineinsetzen einer rund 75 kg schweren Person.
Jenes Konstrukt, das Walter damit nachstellen konnte, ist ein Achterknoten, der auf den ersten Blick korrekt aussieht, aber nicht gänzlich fertig geknüpft ist.
Ja, es ist möglich, den Achterknoten falsch zu knüpfen
und man kann den Fehler auch übersehen.Der Partnercheck muss unbedingt nicht nur visuell,
sondern auch manuell – hin greifen, drehen, anziehen – erfolgen.
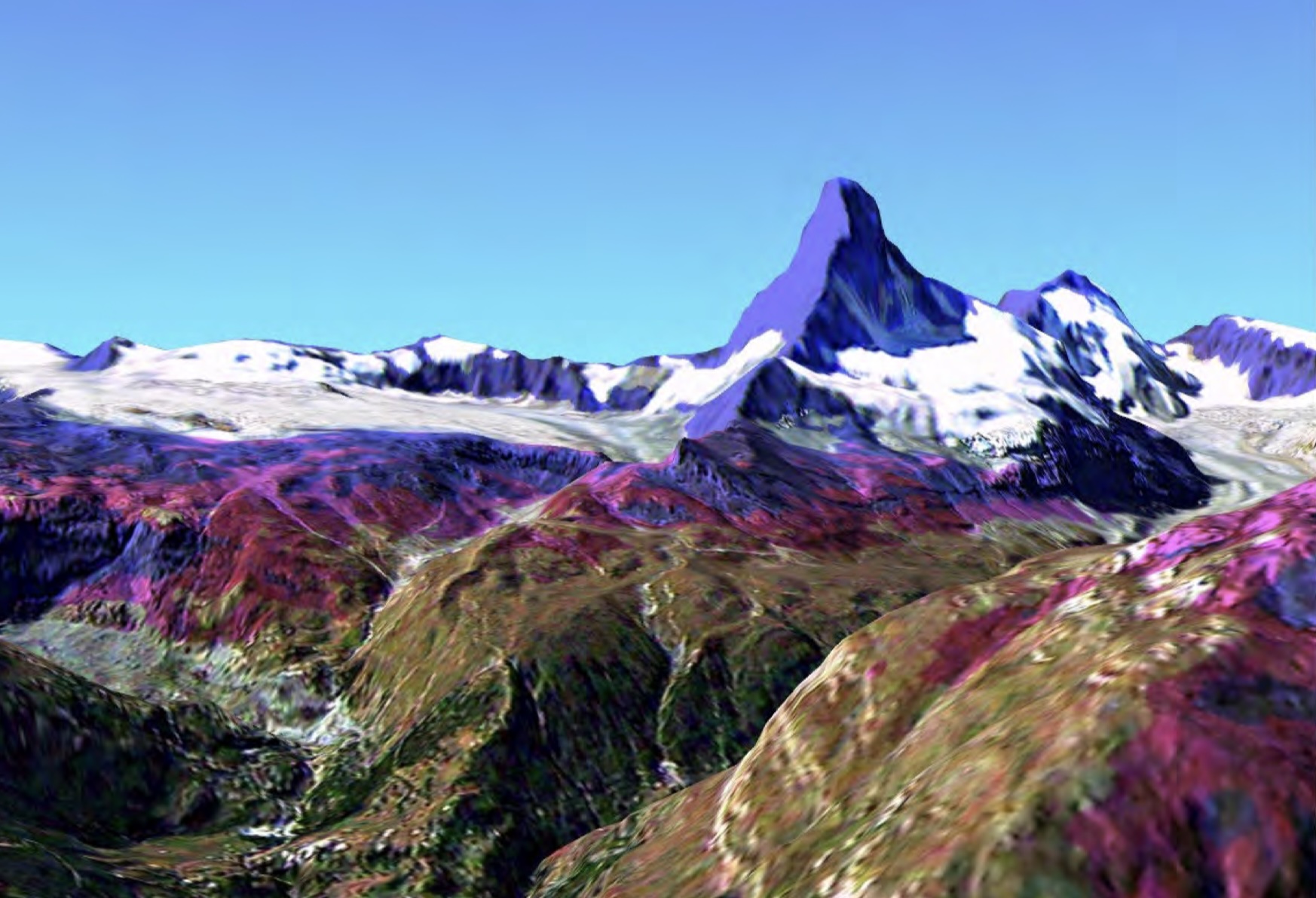
↑ Darstellung Permafrost.
Quelle: Stephan Gruber, Uni Zürich; aus der Präsentation von Jan Beutel.
Klimawandel
Auswirkungen auf die Kryosphäre im Hochgebirge
Jan Beutel
Universität Innsbruck, Studium/Doktorat in Elektrotechnik, Skilehrer/IVBV Bergführer, Professor Universität Innsbruck, 18+ Jahre interdisziplinäre Forschungsprojekte Hochgebirge, Kryosphäre und Naturgefahren, Expertenmitglied ÖKAS und Swiss Permafrost Monitoring Network
GRUNDLAGEN KLIMAWANDEL UND KRYOSPHÄRE
Das Matterhorn als großes Freiluftlabor
Dass sich aufgrund des Klimawandels die Gletscher zurückziehen – und zwar dramatisch, wie Jan Beutel anhand einer Simulation zeigt – und eine ganz andere Landschaft hinterlassen, ist mittlerweile allen bekannt.
Jan Beutel und seine Kollegen arbeiten vor allem am Matterhorn, das ein großes Freiluftlabor darstellt. Aber nicht nur von Schweizer Seite wird hier geforscht, auch auf Italienischer Seite werden schon seit langer Zeit Untersuchungen durchgeführt, wie die Grafik zeigt.

Die Gründe, warum gerade das Matterhorn als Labor so begehrt ist, liegen auf der Hand: Zum einen ist es unglaublich leicht erreichbar. Von Zürich aus ist man in etwas mehr als drei Stunden vor Ort; definitiv also leichter und rascher erreichbar als etwa Grönland oder andere entlegene Orte der Welt.
Außerdem gibt es vor Ort sehr viel Logistiksupport, der die Forschungsarbeit leichter macht. Abgesehen davon ereignete sich am 15. Juli 2003 ein markanter Felssturz am Hörnligrat, bei dem 1.500 bis 2.500 m3 Fels ausbrachen und bei dem innerhalb von nur einer Stunde 84 Alpinisten evakuiert werden mussten. Dieser Felssturz und die Annahme, das noch weitere zu befürchten sind, war der Auslöser, hier am Matterhorn die Forschungsarbeiten zu intensivieren.
Am Matterhorn sollen folgende grundlegende Fragen beantwortet werden:
- Wann werden Felswände instabil?
- Wann passieren Felsstürze?
- Was löst sie aus?
- Welche Auswirkung hat der Klimawandel?
- Welche Auswirkung hat das auf unseren Lebensraum in den Alpen?
Beispiele für Bergstürze in den Alpen und weltweit
Ziel soll sein, Prozesse und Ursachen zu verstehen, um Katastrophen, die zwar nicht sehr oft eintreten, aber dann doch mit dramatischen Folgen (Beispiel Felssturz Piz Cengalo, August 2017, 3,15 Mio. m3) vorhersagen zu können. Direkte Beobachtungen sind sehr selten und passieren meist zufällig mit viel Glück. Der Marmolata-Eisbruch (3. Juli 2022, 65.000 m3, 11 Tote) ereignetet sich beispielsweise gänzlich ohne Voranzeichen, der Felssturz am Weissmies Triftgletscher konnte aber durch eine 3-jährige Beobachtungszeit und die Entwicklung von Methoden vorhergesagt werden – am 10. September 2017 brachen 150.000 m3 Material ab, 220 Personen in Saas Grund wurden rechtzeitig evakuiert.
Vor allem wenn Felsmaterial auf Eis trifft, kommt es zu Kaskadeneffekten, denn durch die Energie des aufprallenden Felsmaterials wird das Eis sofort geschmolzen und eine Masse aus Fels, Schutt und Wasser bewegt sich sehr schnell talwärts. Ein solches Ereignis kann noch ganz andere Ausmaße wie am Piz Cengalo annehmen, wie ein Beispiel aus Indien, Nanda Devi/Chamoli Garhwal Himalaya, zeigt, bei dem am 3. Februar 2021 27 Mio. m3 Material abbrachen. Zwei Flusskraftwerke und fünf Dörfer wurden völlig zerstört und bis heute werden mehr als 200 Menschen vermisst. Und es geht sogar noch ein wenig größer: Am Elliot Creek, BC, Canada, brachen am 20. November 2020 50 Mio. m3 ab. Die Wasser-Staublawine raste mit 140 km/h talwärts und löste eine 100 m hohe Tsunami Welle aus. Oder auch das Ereignis am Lamplugh Glacier, BC, am 23. Juni 2016 mit 150 Mio. m3 bei dem sechs Jahre später noch ein zweiter Felssturz nach kam. Sprich, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn einmal ein Felssturz passiert ist, das Material unten ist und es nicht noch einmal zu einem derartigen Ereignis kommen kann.
Tatsächlich kracht es in den Ostalpen nicht häufiger als in den Westalpen (was man annehmen könnte, weil die Berge niedriger sind und die Ausaperung schon weiter fortgeschritten ist), aber auch hier finden sich Beispiele: Fluchthorn am 11. Juni 2023 mit 1 Mio. m3 oder auch am Piz Scerscen am 14. April 2024 mit mehr als 5 Mio. m3. Beide Ereignisse seien angeblich völlig ohne Vorzeichen passiert, wie Augenzeugen berichteten. Aber natürlich gab es Vorzeichen, die allerdings nicht erkannt wurden, weil die Sensibilisierung und das Fachwissen zu wenig stark ausgeprägt sind. Spannend am Fluchthorn ist sicherlich, dass hier zwei geologische Komponenten aufeinander treffen. Genau am Übergang ist es zum Abbruch gekommen. Selbst für die Wissenschaft erstaunlich ist aber, dass die Abbruchstelle komplett trocken war. Ganz im Gegensatz zum Piz Scerscen, wo tagelang flüssiges Wasser an der Abbruchstelle austrat, obwohl dieses in dieser Höhenlage gefroren hätte sein müssen.

↑ Große Bergsturzereignisse sind immer noch selten.
Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.
DAS KLIMASYSTEM DER ERDE UND DER KLIMAWANDEL
Das Klimasystem der Erde wird durch die Energie der Sonne angetrieben. Sie treibt die verschiedenen Kreisläufe über Wasser und über Land an, wobei der Wasserkreislauf wesentlich ist.
Die Definition von „Klimawandel“ geht historisch auf jemanden zurück, den man gar nicht damit verbindet: Alexander von Humboldt (1769–1859). Er hat ein erstes Diagramm über die Höhenstufen in den Anden angefertigt. Zu nennen ist auch John Tyndall (1820-1893), ein großartiger Alpinist und Forscher, der neben grundlegenden physikalischen Eigenschaften auch Gletscherbewegungen beobachtet hat. Er war fast der Erstbesteiger des Matterhorns – damals verlor er das Rennen gegen Whymper und Carell. In Bezug auf den Klimawandel war er der erste, der den Zusammenhang zwischen Wasserdampf, Kohlendioxid und Temperatur in der Atmosphäre festgemacht hat. Diesen Zusammenhang kann man heute mit Hilfe von Bohrkernen aus Eis und aus Sedimenten relativ lange zurückverfolgen und man sieht auch, dass die Konzentrationen sich immer wieder verändert haben und es mehrere Eiszeiten und Warmzeiten gab. Wenn nun jemand sagt, Klimawandel gab es schon immer und findet in Wellen statt, dann stimmt das im Langzeitkontext – wir befinden uns aktuell in einer Zwischen-Eiszeit. Selbst in jüngerer Zeit, in den letzten 2.000 Jahren, hat es immer wieder Temperaturschwankungen gegeben – die sogenannte Mittelalterliche Klimaanomalie zeigt, dass es kältere Phasen gab, in denen es der Bevölkerung nicht so gut ging. Diese Phase in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends n. Chr. wird sogar als „Kleine Eiszeit“ bezeichnet.
Mit der Erfindung der Dampfmaschine und dem Beginn der Industrialisierung um 1880 gehen die Temperaturen nach oben – in den letzten Jahrzehnten sind sie quasi nach oben geschossen.
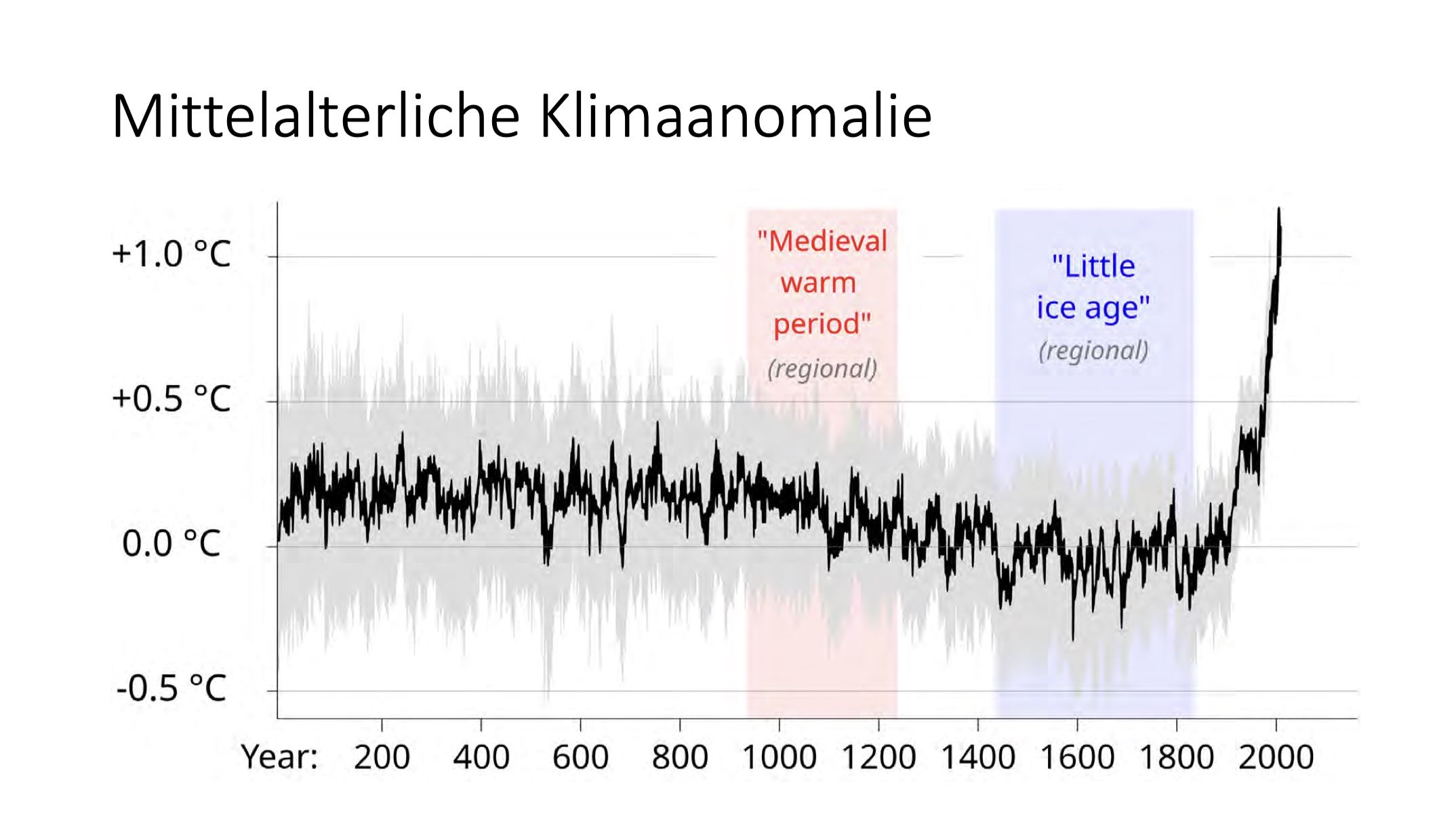
Die Korrelation zwischen CO2 und Temperatur wird seit vielen Jahren durch die Messung des atmosphärischen CO2-Gehaltes durch die Messanstalt Mauna Loa auf Hawaii gemessen. In den letzten 60 Jahren stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre um 30 Prozent. Damit steigt auch die Temperatur, da das Sonnenlicht zwar ungehindert auf die Erde trifft, aber nur ein Teil wieder in die Atmosphäre abgestrahlt wird. Der andere Teil wird durch Kohlenstoff- und Wasserstoffmoleküle wieder zurückreflektiert.
Besonders warme Jahre sind lange schon keine seltenen Ausreißer nach oben mehr, sondern die positiven Temperaturabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel sind bereits zu einem neuen „Normal“ geworden.
Überall auf der Erde gehen die
Temperaturen durch die Decke.
Um das darzustellen, gibt es verschiedene Grafiken. Besonders eindrücklich ist die „Daily Surface Air Temperature“, weil man hier die Temperaturen auch saisonal aufgeschlüsselt sieht. Beeindruckend ist nicht nur, dass die Temperaturen immer höher werden, sondern dass auch der Abstand zum vorherigen Jahr immer größer wird.
Global gesehen gibt es allerdings auch starke regionale Unterschiede. Europa ist von einer relativ starken Erwärmungsblase betroffen. Die Folge ist, dass nicht nur das Wetter im Mittel wärmer wird, sondern dass sich auch die Niederschlagsverteilung massiv verändert. Die Modelle prognostizieren einen Temperaturanstieg in allen Monaten, vor allem im Sommer, und einen starken Anstieg der Niederschläge im Winter (November bis März) bei gleichzeitig starker Reduktion der Sommerniederschläge (Juni bis September). Die Gefahr von heftigen, Gewittern mit Starkniederschlägen auf kleinem Raum, Hagel und Sturm steigt, weil mehr Energie im System ist. Außerdem verändert sich der jahreszeitliche Abfluss der Flüsse: Die höchsten Abflüsse sind nicht mehr im Juli und August zu erwarten, sondern bereits im April.
PROZESSE IN DER ALPINEN KRYOSPHÄRE
Um zu verstehen, was sich aktuell bei uns im Hochgebirge tut, muss man sich Prozesse hinsichtlich Eis, Permafrost, Felsstabilität und Massenbewegungen ansehen.
Extremer Gletscherrückgang
Ganz klar und deutlich ist der extreme Gletscherrückgang, den vermutlich alle kennen. Dieser Rückgang (bis auf ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen) manifestiert sich weltweit. Geht der Gletscher zurück, bedeutet das nicht nur, dass hier weniger Eis ist, sondern es entsteht auch eine völlig neue Landschaft. Es entstehen Seen und es wird grüner. Abgesehen davon verändert sich der Wasserhaushalt und die Berge werden steiler. Weltweit beobachtet man zudem eine großflächige Destabilisierung, sprich viel loses Material wird frei. Heute gibt es Zonen, wo es aufgrund von Steinschlag richtig ungut wird. In den Alpen gibt es gemessene Bodenbewegungsraten von bis zu über 100 m pro Jahr.
Dazu kommen Nutzungskonflikte – beispielsweise in Gletscherskigebieten.
Beim Bergsteigen sind die Alpinisten wieder mehr gefordert, Wissen um alpine Gefahren und Erfahrung ist wichtiger denn je. Wo man früher gemütlich über Firn gegangen ist, muss man heute völlig neue Anstiege finden, Beispiel Wildspitze.
Ganze Berge müssen sich durch den Verlust des Eispanzers
und den Wegfall des Gewichtes eine neue Balance suchen.
Abgesehen davon hat das Eis auch in der Tiefe gewirkt und war ein Schutz gegen die Verwitterung. Heute liegen ganze Blöcke eis- und schneefrei dar und sind den Elementen (Sonne, Regen, Frost) schonungslos ausgesetzt.
Wir müssen uns also anpassen. Es kann vorkommen, bzw. kommt schon vor, dass wir manche Infrastruktur aufgeben und/oder neue Standorte finden müssen, Beispiel Bivouac Meneghello.
Auftauender Permafrost
Nicht nur an der Oberfläche sind Veränderungen zu beobachten, sondern auch im Boden: Permafrost ist Felsen, Erde und Schutt, der das ganze Jahr gefroren ist. Im Gegensatz zu Eis und Schnee kann man Permafrost nicht sehen.
Im Sommer taut Permafrost an der Oberfläche auf. Permafrost kommt überall dort vor, wo die Außentemperatur kalt genug dafür ist – sprich in arktischen Regionen, im Hochgebirge, an Nordflanken. Permafrost kann bis zu 100 Meter tief in den Boden reichen. Die Auftauschicht, also jene Schicht, die jedes Jahr im Sommer auftaut, kann einige Meter bis 10 Meter betragen.
Permafrost kommt auf ca. 25 Prozent der Landmasse der Nördlichen Hemisphäre vor – sogar am Meeresboden. In den Alpen nimmt der Permafrost dreimal die Fläche der Gletscher ein. Auf sogenannten „Hinweiskarten“ wird versucht, Permafrost darzustellen. Dabei handelt sich allerdings nicht um eine normale topografische karten, sondern dargestellt werden Wahrscheinlichkeiten. Wo die Farbe der Karte ins Dunkelrot geht, ist Permafrost sehr wahrscheinlich. Generell kann man sagen, dass bei uns in den Alpen Permafrost ab rund 2.500 Metern vorkommt, wobei Studien gezeigt haben, dass dies für die Slowenischen Alpen nicht unbedingt zutrifft, weil das Klima kontinentaler ist. Ausschlaggebend ist zudem immer die Klimazone.
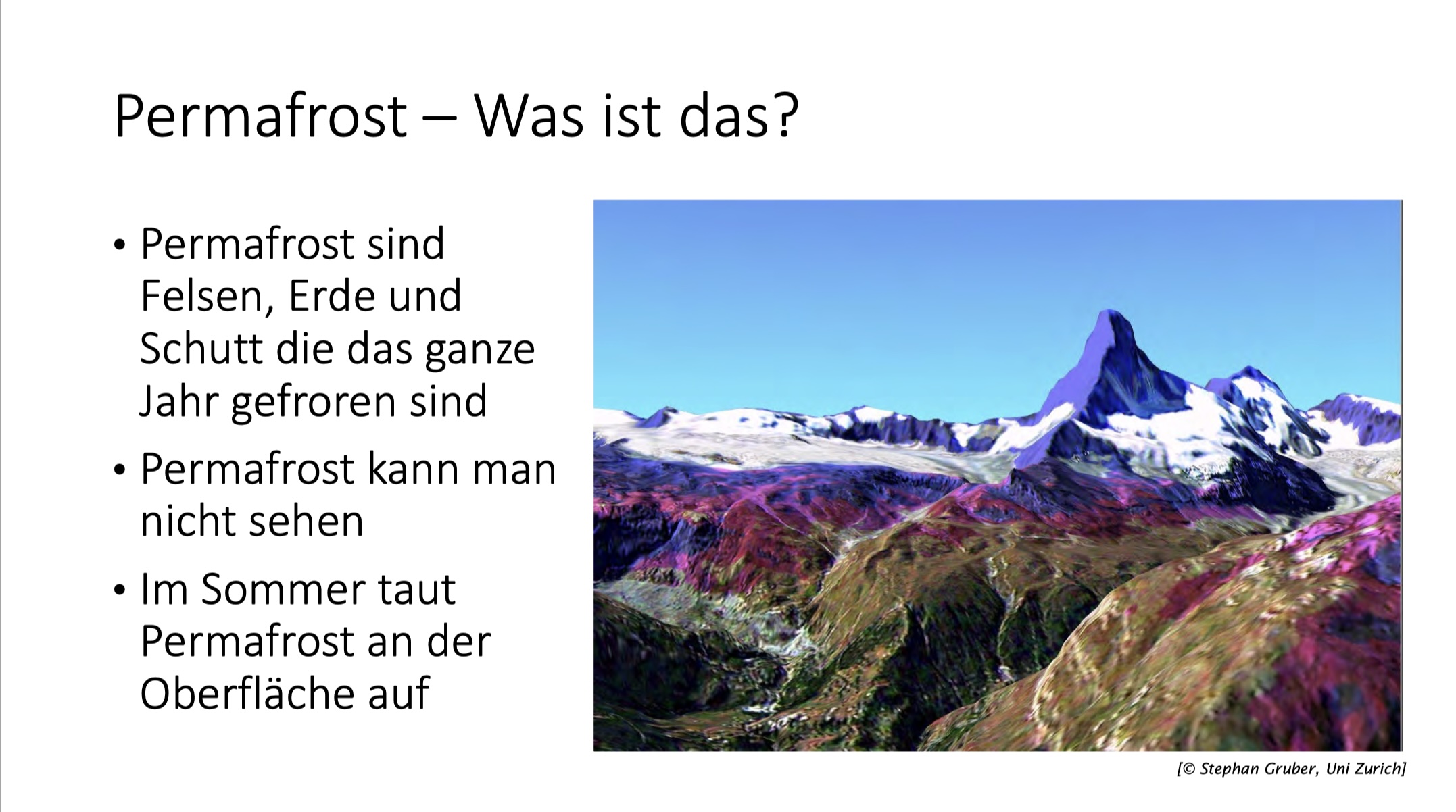
↑ Was ist Permafrost?
Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.
Jedenfalls sieht man weltweit einen Trend dahingehend, dass der Permafrost auftaut. Schließlich beeinflussen Wetter und Klima den Permafrost: Im Jahreszyklus sieht man sofort Veränderungen – die Auftauschicht vergrößert sich, es kommt zu einer Schmelze am Permafrostspiegel. Sieht man sich ganze Dekaden an, ist die Verändert verzögert sichtbar – es kommt zu einer Deformation der Temperaturprofile und zu einer Reduktion des Wärmeflusses und der Inversion. Im Zeitraum von Jahrhunderten kommt es zu einem Gleichgewicht: Anstieg der Permafrostbasis oder sogar komplette Degradation des Permafrostes, Veränderung der Permafrostverbreitung und Anpassung der Oberflächenprozesse (Erosion, Boden, Vegetation etc.).
Ein ständiges Auftauen eines Felsblocks hat Konsequenzen. Wiederholte Gefrierprozesse erzeugen Eislinsen – ein Versuch im Labor kann dies gut nachweisen. Schlaglöcher auf der Straße entstehen auf die gleiche Weise. In der Arktis tauchen plötzlich Löcher auf, es bilden sich sogenannte Strukturböden im Thermokarst. Auch vertikale Eislinsen wurden beobachtet sowie sogenannte Palsen und Pingos. Das Auftauen des Permafrostes führt zudem zu großflächiger Erosion an arktischen Küsten.
„Permafrost im Gebirge unterscheidet sich
wesentlich von Permafrost in Polarregionen.“
Im Gebirge ist es viel steiler, es gibt verschiedene Expositionen und Höhenstufen, alles ist viel kleinräumiger und die Variabilität ist hoch. Wasser dring in Ritzen und Klüfte ein, es kommt zu Gefrier- und Auftauprozessen. Umweltbedingungen und Schwerkraft zusammen verursachen in Folge Massenbewegungen.
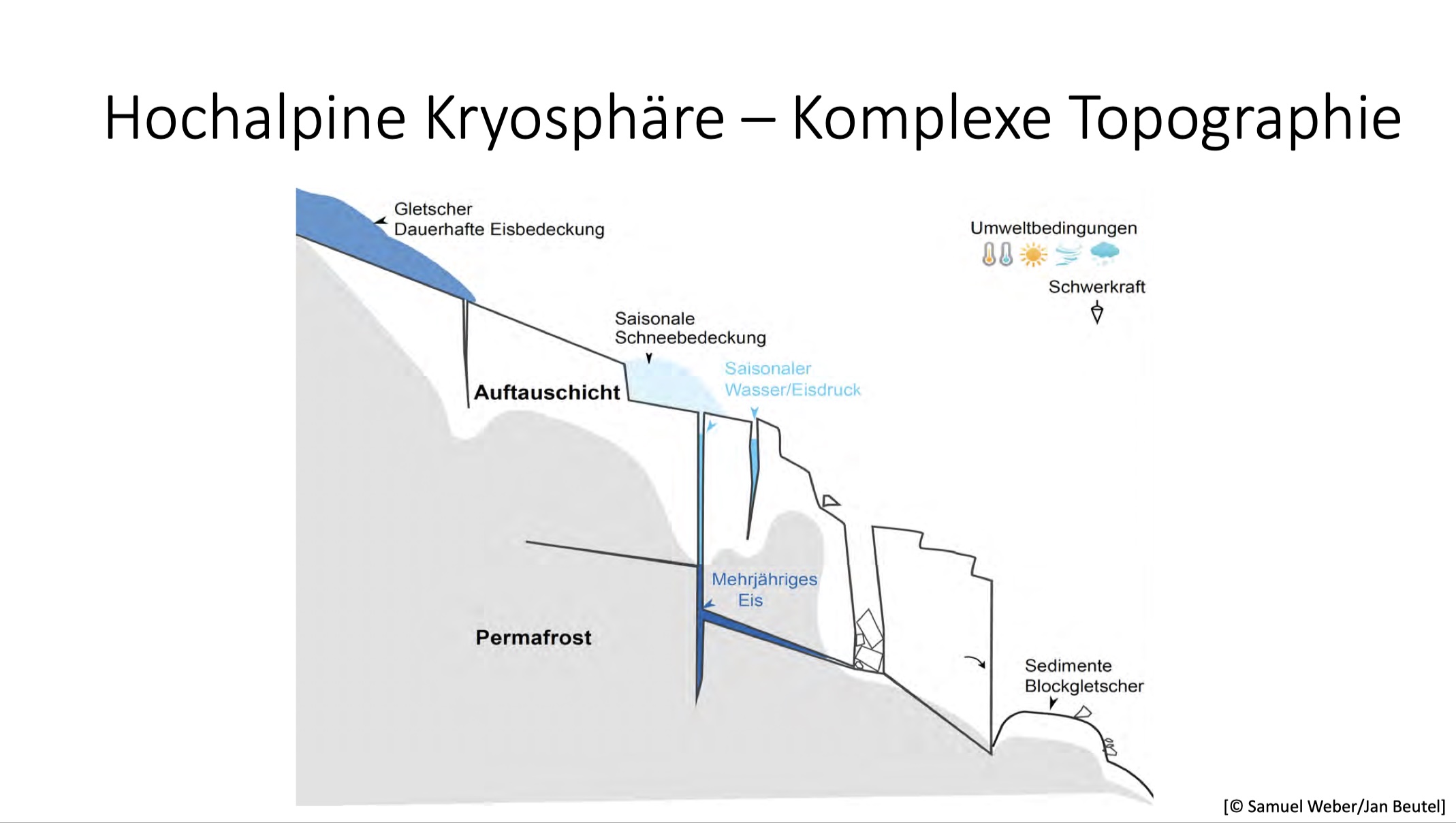
↑ Auftauprozesse Permafrost im Gebirge.
Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.
Im Gebirge gibt es typische Landschaftsformen, die auf Permafrost hinweisen: hochalpine Felswände, Schutthalden, stark zerrissenes Gelände mit einem Mix aus Schutt und Felsen. Und natürlich Blockgletscher, die tatsächlich gefrorenen Boden mit mehr oder weniger Eis darstellen und sich unheimlich schnell talabwärts bewegen und dadurch die Permafrostgrenze nach unten verschieben. In der Schweiz weisen ca. 5 Prozent der Landesfläche Permafrost auf, in Österreich ca. 2 Prozent.
Die Interaktion zwischen dem vielfältigen Wetter und dem Klima spielt für den Permafrost im Gebirge eine zentrale Rolle: Schneidet man eine Bergspitze in der Mitte von Nord nach Süd durch, sieht man, das auf der Südseite die Permafrostgrenze natürlich weiter nach oben reicht, während die Nordwand bei entsprechender Höhenlage tatsächlich oft durchgehend von Permafrost durchzogen ist. Prognosemodelle zeigen, dass selbst auf der schattigen Nordwand des Matterhorns der Permafrost in den nächsten 200 Jahre stark zurückgehen wird.
Permafrost wird weltweit und auch in den Alpen überwacht und gemessen. Das Schweizer Überwachungssystem ist momentan sowohl operativ als auch organisatorisch weltweit führend. In Österreich fehlt dazu ein staatliches Mandat. Das gesamte Kryosphärenmonitoring (wozu die Gletschermessung zählt) wird hierzulande von „hochmotivierten Individuen mit ihrem Taschengeld“ betrieben. In der Schweiz gibt es über die Kryosphärenkommission von der Bundesregierung ein Mandat.
Zur Permafrostüberwachung werden 10 Meter tiefe Bohrlöcher gesetzt. Viele dieser Messstationen in der Schweiz zeigen, dass vielerorts die Bodentemperatur bereits an der 0-Grad-Grenze ist. Im Vergleich zur Temperaturmessung in den Alpen (ab 1860) gibt es die Permafrostmessung noch nicht so lange. Das älteste Bohrloch ist etwas über 30 Jahre alt.
Unter Beobachtung stehen vor allem Blockgletscher, die unglaublich komplex sind. Mit ihnen bewegen sich ganze Talflanken. Im Mattertal wurde dazu ein großes Forschungsprojekt gestartet, das alle rutschenden Blockgletscher oder größere andere Massenbewegungen beobachtet. Stationäre GPX auf den Felsplatten rutschen mit und fangen die Bewegung ein. Ziel ist die Erstellung von Modellen und Vorhersage, aber auch Wahrninstrumente für die Gemeinden zu entwickeln.
Seit Oktober 2022, sind Blockgletscher Geschwindigkeiten
als wesentlichen Klimavariablen (ECV) anerkannt.

Zunahme des Steinschlags in warmen Perioden
In Aig. Chamonix hat man alle Steinschlagereignisse von den 40er-Jahren bis heute kartiert und kann tatsächlich feststellen, dass die Absturzereignisse zunehmen. Damit versucht man, Computersimulationen zu füttern, um Sturzprozesse zu veranschaulichen.
Der Grund für Steinschlag ist Materialversagen. Mat hat dazu verschiedene Gesteinsproben mit ins Labor genommen, immer wieder gefroren und aufgetaut und beobachtet, wann der Stein bricht. Gleiche Versuche wurden bereits in den 70er-Jahren durchgeführt. Man weiß also schon jetzt, dass – je nachdem in welche Richtung man zieht – man 70 Prozent Festigkeitsverlust rein durch das Auftauen hat. Ausschlaggebend ist zudem die Wassersättigung des Gesteins sowie der Winkel, bei dem es zum Abbruch kommt.
REAKTIONEN UND ANPASSUNGEN
Die Anpassung an das Event am Piz Cengalo im Jahr 2014 und dann vor allem im Jahr 2017, bei dem auch Tote zu beklagen waren, ist immer noch am Laufen. Aktuell gibt es am Schweizer Bundesgericht einen Rekurs mit nicht nur einer Anklage gegen die Gemeindepräsidentin, sondern auch gegen Experten/Gutachter. Vier Personen in Summe sind wegen dem Kapitalverbrechen „Fahrlässige Tötung“ angeklagt. Eine schaurige Entwicklung.
Das zweite Beispiel ist der erste signifikante Felssturz in einem geöffneten Skigebiet – am Pitztaler Gletscher in Österreich Ende Oktober 2024 – auf eine geöffnete Skipiste. Zum Glück fand das Ereignis in der Nacht statt. Darüber wurde nur zögerlich informiert und auf Nachfrage gemauert. Dies ist ein unglaublicher Präzedenzfall in einem servicierten, haftbaren Raum. Sieht man sich die Luftbilder der vorherigen Tage an, sieht man durchaus, dass auch schon zuvor einige Steine heruntergekommen sind – sprich, es waren Vorzeichen zu sehen. In Zukunft stellt sich vielleicht weniger die Frage, ob man hier aufgrund der Schneebedingungen noch Skifahren kann, sondern vielleicht eher, ob die Betriebshaftpflichtversicherung über diese Sachen nachdenkt.
Fallbeispiele von Steinschlag, Fels- oder Gletscherbrüchen
in Form von Fotos und Videos sind jederzeit sehr willkommen!
Häufung von Alpinunfällen im Kontext Klimawandel
und die Beurteilung im gerichtlichen Verfahren
Walter Würtl und Peter Plattner
Alpin-Sachverständige Innsbruck
DEFINITIONEN
Wetter
… beschreibt kurzfristige atmosphärische Bedingungen an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es umfasst Temperatur, Niederschlag, Wind und andere meteorologische Elemente, die sich stündlich ändern können.
Witterung
… wird der allgemeine, durchschnittliche oder auch vorherrschende Charakter des Wetterablaufs eines bestimmten Zeitraums, von einigen Tagen bis Wochen bezeichnet.
Klima
… beschreibt Durchschnittswerte und Muster des Wetters über einen längeren Zeitraum (typischerweise in 30-Jahren-Perioden z. B.: 1961-90 / 91-2020 oder mehr). Es berücksichtigt die gleichen meteorologischen Elemente wie das Wetter, aber in einem viel größeren zeitlichen Rahmen, um Trends und Veränderungen im Verhältnis zum jeweiligen Bezugszeitraum zu erkennen.
Fakt ist, die Temperatur nimmt aktuell zu.
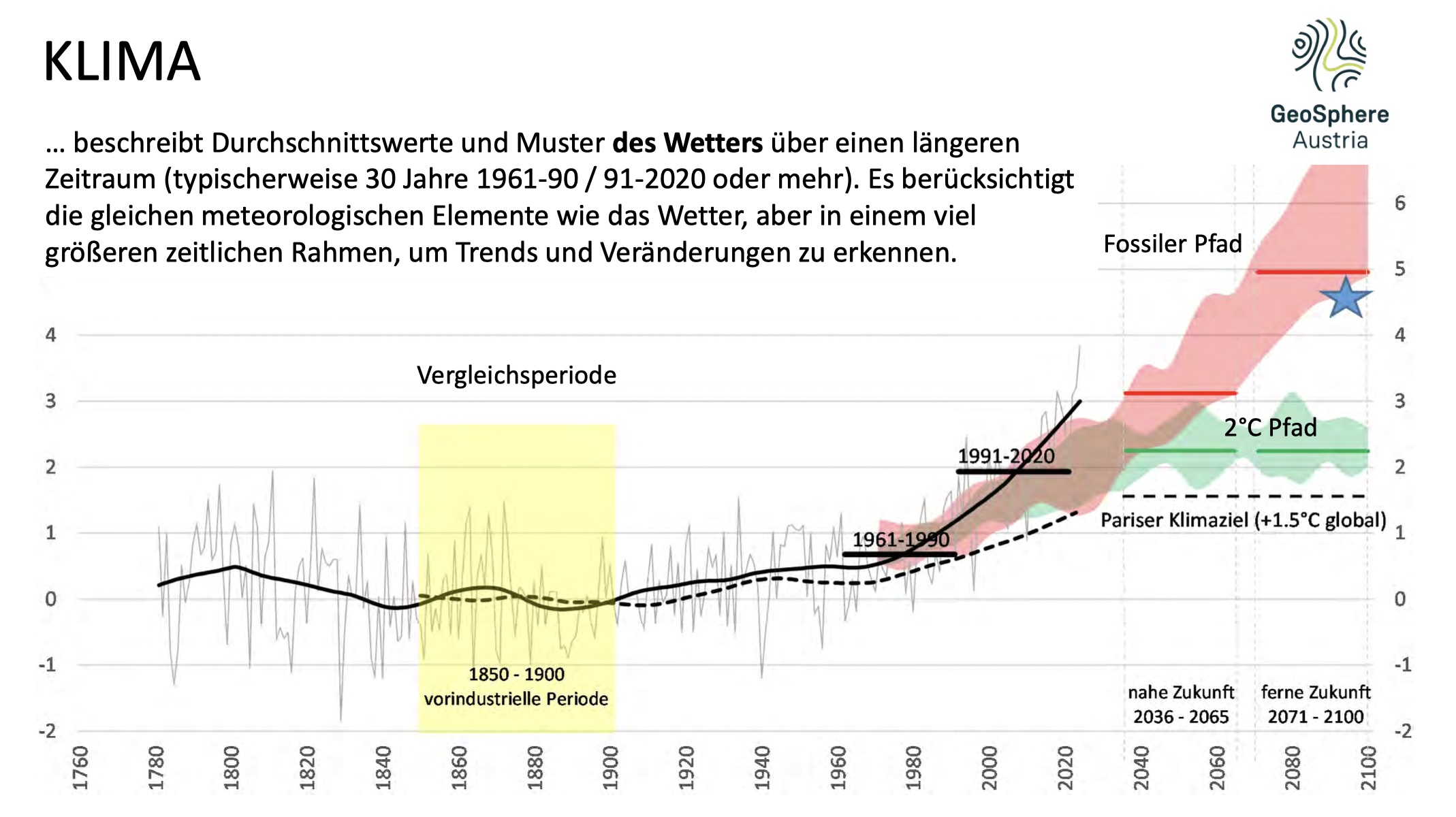
Das Klima auf der Erde ist einem ständigen Wandel unterworfen. In den vergangenen Jahrmillionen ist es immer wieder wärmer und kälter geworden. Für uns Menschen ist aber vor allem die aktuelle Entwicklung von Bedeutung, da wir diese Veränderung hautnah miterleben.
Im Bereich des Brunnenkogels ist z. B. durch die Ausaperung des Gletschers ein tolles Klettergebiet mit Mehrseillängentouren in kompaktem Fels auf 3.000 m entstanden.
Beim Bergsteigen ist das Wetter entscheidend,
das Klima ist egal!
ELEMENTARE GRUNDLAGEN ZUM KLIMAWANDEL IN DEN BERGEN
Nichts desto trotz sieht man, dass die Temperatur überall auf der Erde stark nach oben geht. Dadurch kommen Nachteile auf uns zu, die man ansprechen muss. Die fünf wärmsten Winter der Messgeschichte liegen aller in der jüngsten Vergangenheit.
Die Bilder zeigen den Niederschlag und die Temperatur in Europa im Jahr 2024 im Vergleich zur Klimaperiode 1991 bis 2020:
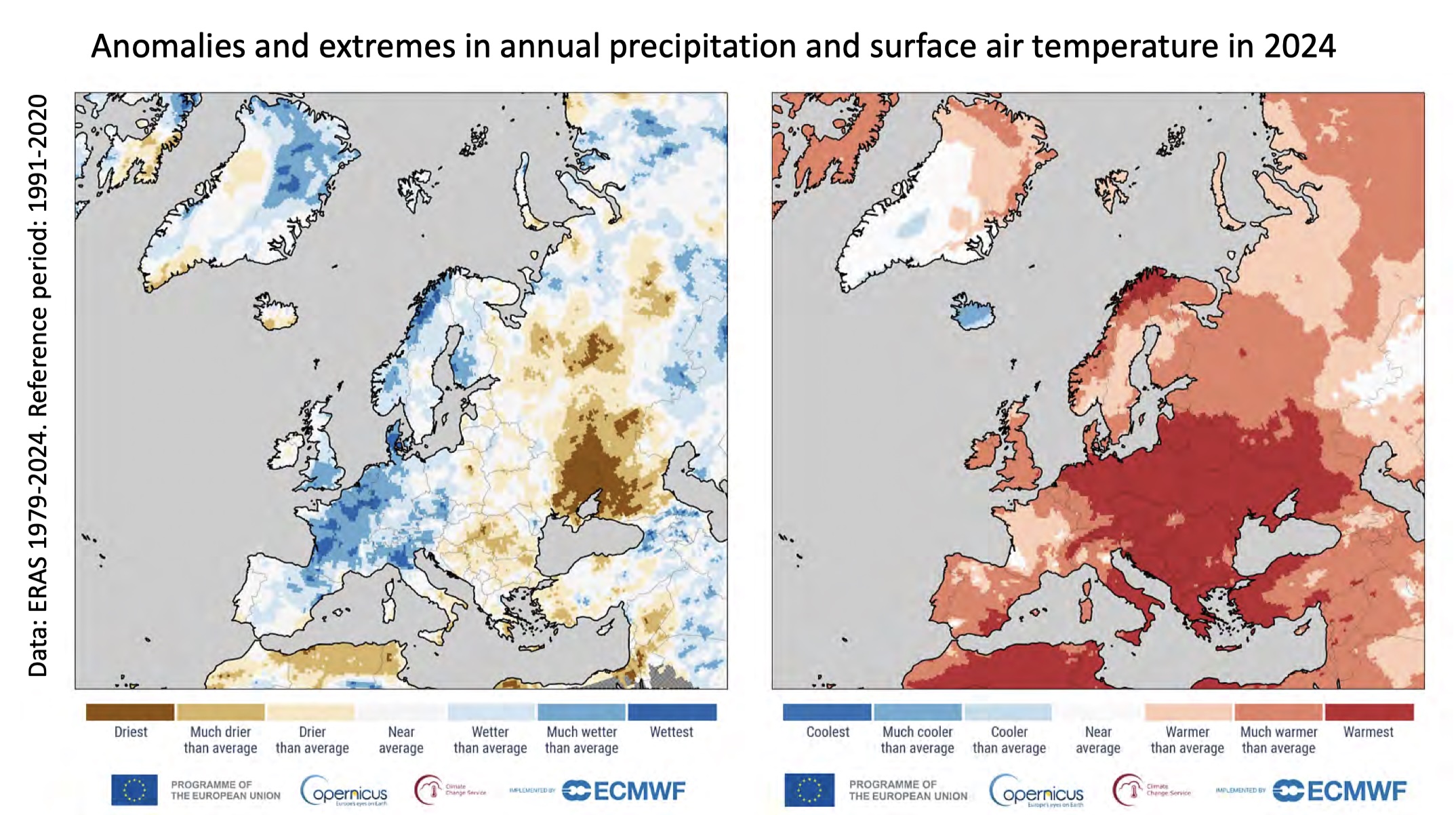
↑ Quelle: Aus der Präsentation von Walter Würtl.
Das Jahr 2024 war global gesehen das wärmste je gemessene Jahr. Gleichzeitig war es in Mittel- und Nordeuropa auch sehr feucht, wobei die Schneetage in Mitteleuropa weniger waren als im Vergleichszeitraum – sprich Niederschlag fiel in niedrigen Lagen nicht in Form von Schnee, sondern als Regen. Ein Trend, der sich auch im langfristigen Vergleich zeigt – d. h. die subjektive Wahrnehmung, dass die Schneehöhen bzw. die Tage mit durchgehender Schneebedeckung abnehmen, täuscht nicht. Davon abgesehen nehmen aber Starkniederschlagsereignisse zu und zwar nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Heftigkeit – d. h. in kurzer Zeit fällt punktuell sehr viel Niederschlag, was zu Problemen führen kann – Stichwort „alpine Naturgefahren“.
Interessant ist auch ein Vergleich der Frosttage (T-minimum unter 0°C). Diese haben im Mittel um -13,8 auf 135 Tage abgenommen (ca. -10 %).
Eistage (T < 0°C) zeigen für die meisten bewohnten Regionen Österreichs eine Reduktion um 20 bis 40 Prozent.
Die Frost-Tau-Wechseltage haben dafür in Lagen über 1.500 m um bis zu 10 Tagen zugenommen, während sie in tiefen Lagen um etwa 12 Tage abgenommen haben. Genau diese Frost-Tau-Wechsel sind aber Gift für das Gestein: Wasser dringt in das Gestein ein und friert. Es entstehen Eislinsen, das Eis dehnt sich aus, wodurch es zur Frostsprengung kommt, und beim Wiederauftauen rutschten Blöcke im Bereich der Eislinsen ab.
Es gibt also Änderungen beim Wetter und beim Klima im Gebirge, die Auswirkungen auf uns haben:
- höhere Lufttemperatur (… mehr Energie in der Atmosphäre!)
- Zunahme von Frost-Tauwechseltagen im Gebirge > 1.500 m
- weniger Schneetage, geringere Schneehöhen, steigende Schneefallgrenze – trotzdem „Starkschneeereignisse“
- mehr Starkniederschlagsereignisse und höhere Regenmengen bei Starkniederschlagsereignissen
- steigende Wahrscheinlichkeit für Stürme (Starkwindereignisse) und verstärkte Intensität
Der globale Temperaturanstieg führt zudem zur Gletscherschmelze und zu einem Auftauen des Permafrosts (Steinschläge und Felsstürze auch in Skigebieten, ORF-Meldung).
Wobei nicht alles auf den Permafrost zurückzuführen ist – oft spielt auch die Geologie eine wesentliche Rolle – wie z. B. beim alten Zustieg auf die Oberwalder Hütte. In Zusammenhang mit der Wegerhaltung wird es dann allerdings auch in gutachterlicher Hinsicht bereits interessant. Es stellt sich die Frage, ob der Wegehalter seiner Verpflichtung entsprechend nachgekommen ist, ob und wie er auf Veränderungen reagiert hat.
BEURTEILUNG IM GERICHTLICHEN VERFAHREN
TOURENPLANUNG hat besonderen Stellenwert, was das WETTER und die aktuellen VERHÄLTNISSE angeht!
Dies wird im Falle eines Unfalles jedenfalls für die Beurteilung relevant sein, denn man kann durchaus voraussetzen, dass mittlerweile jeder weiß, dass sich die Bedingungen geändert haben und nicht jede Tour zur selben Zeit oder über den selben Aufstieg wie früher gegangen werden kann. Zusätzlich müssen Anzeichen für Steinschlag, Block- und Felssturz bzw. die spezifischen Gefahrenstellen von einem Bergprofi (Bergführer, Wanderführer, sonstige Leute in Garantenstellung) erkannt werden! Diese Person muss in der Lage sein, tagesaktuell zu beurteilen, ob die Tour machbar ist oder nicht.
Sieht man sich die Steinschlagereignisse bei den relevanten Bergsportdisziplinen an, ist allerdings (noch) keine signifikante Steigerung zu sehen:
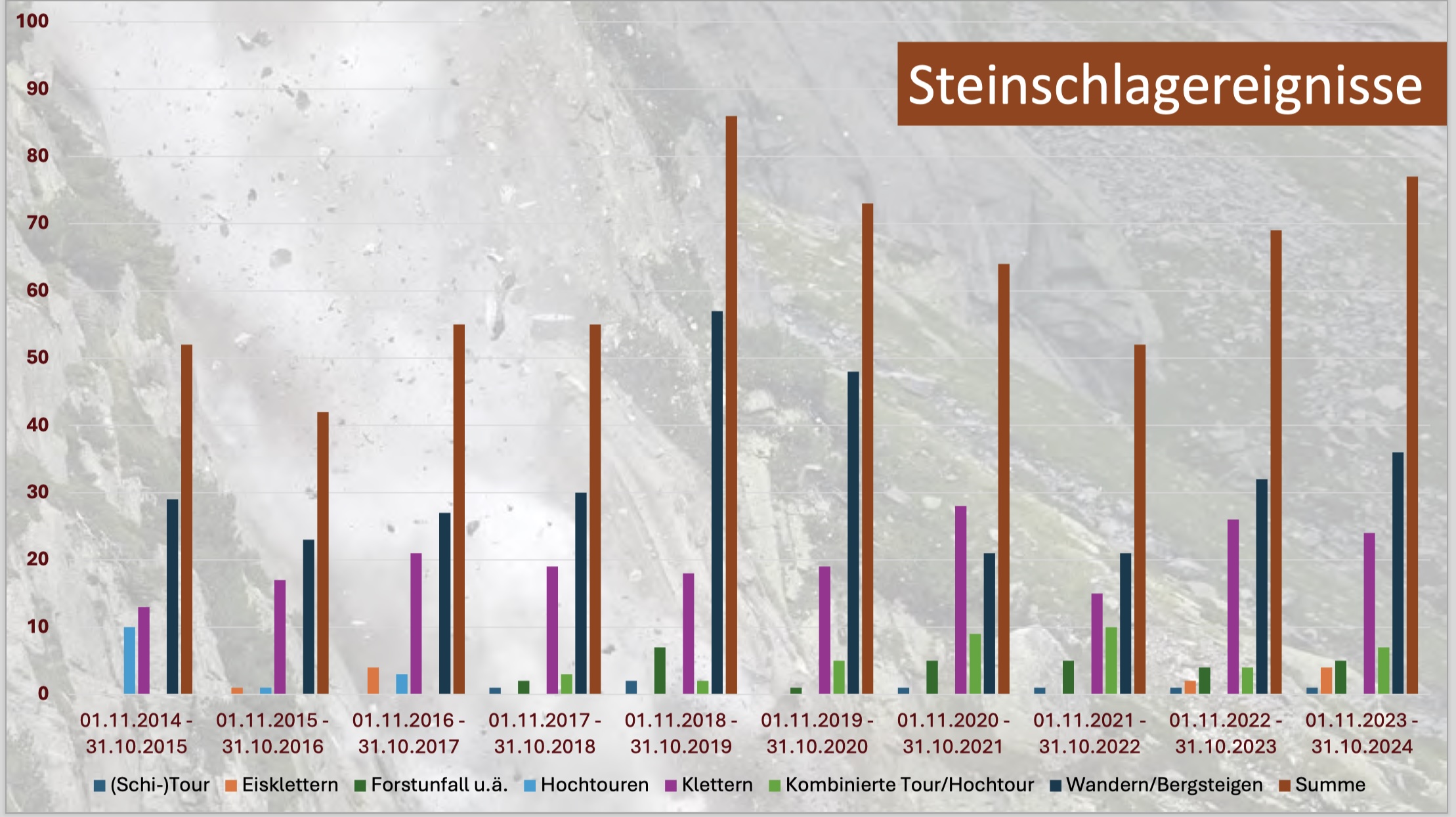
Eine eindeutige Klimaindikation lässt sich aus den Zahlen des ÖKAS nicht ablesen. In der alpinen Unfalldatenbank erfasste Steinschlagereignisse sind vor allem ausbrechende Griffe oder Tritte in Klettertouren, Steine lösen sich beim Abziehen des Seiles oder Menschen oder Tiere treten Steine ab. Diese Ereignisse gab es vor 10 oder 15 Jahren ebenso und die Anzahl ist nicht gestiegen.
Beispiel Matterhorn
Aufgrund der Schneeschmelze und des Gletscherrückgangs ist der Gipfel im Sommer praktisch eis- und schneefrei. Die FAZ titelte am 27.7.2022: „Gipfel ist durch hohe Temperaturen völlig schneefrei. Ein Bergsteiger kam ums Leben – Zermatter Bergführer haben Touren eingestellt.“ Daran erkennt man die gesellschaftliche Relevanz. Die lokalen Bergführer führten die Touren aufgrund der aktuell schlechten Verhältnisse nicht, sondern warteten ab und gaben an, die Lage in ein paar Tagen neu beurteilen zu wollen. Man wolle auf eine Wetteränderung mit Abkühlung und Niederschlag warten. Vor allem loses Gesteinsmaterial könne zum Problem werden, wenn viele Bergsteiger am Berg unterwegs sind, die wenig Ahnung in Sachen Seilführung haben. Leicht könne es zum Abtreten von Steinen kommen, die darunter gehende Seilschaften gefährden könnten. Ein „Abräumen“ von losem Gesteinsmaterial käme in Frage – wie das bereits drei oder viermal gemacht worden sei.
Der Berg wurde also nicht behördlich gesperrt. Wenn aber die Zermatter Bergführer die geführten Touren einstweilen einstellen, dann ist davon auszugehen, dass sie das mit gutem Grund tun. Für eine Beurteilung im gerichtlichen Verfahren könnte dies durchaus herangezogen werden, im Besonderen dann, wenn ein nicht lokaler Bergführer mit seiner Gruppe trotzdem geht und es passiert etwas. Gute Argumente könnten dann rar sein.
Beispiel Starkschneeereigniss Zermatt Ostern 2025
Diese Starkschneeereignisse werden nicht weniger werden – ganz im Gegenteil. Durch insgesamt wärmere Temperaturen kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen und es kann dann eben in entsprechender Höhenlage bzw. mit der entsprechenden Wetterlage (kältere Temperaturen aus dem Norden) durchaus zu derartigen Starkschneeereignissen in sehr kurzer Zeit kommen. Zu Ostern 2025 war z. B. die Straße nach Zermatt aufgrund des vielen Schnees geschlossen.
Vor allem Lawinenkommissionen sind gefordert. Sie stehen immer im Einsatz, machen einen täglichen Basischeck und erweiterte Checks im Gelände. Das Schließen der Straße ist dabei meist noch einfach, schwierig ist die Entscheidung, wann die Straße wieder freigegeben werden kann.
FAKTEN AUS DER ALPINEN UNFALLSTATISTIK (ÖKAS)
Lawinenereignisse und Klimawandel
Beim ÖKAS werden die Lawinenunfallzahlen mit dem Wetter verschnitten; das Klima haben wir im Hinterkopf. Ausschlaggebend für den Schneedeckenaufbau ist der Wetterverlauf des Winters insgesamt. Für die Unfallzahlen spielt dann aber vor allem das aktuelle Wetter eine Rolle – wenn mehr los ist, passiert auch mehr. Die Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Lawinentoten rückläufig ist.
Im Winter 2022/23 hat es beim Skitourengehen erstmals
mehr Herz-Kreislauf-Tote gegeben als Lawinentote (8).
Warum die Zahl der Lawinentoten trotz steigender Anzahl an Skitourengeher abnimmt, kann mehrere Gründe habe: Vielleicht weil die Präventionsarbeit greift, oder einfach, weil die Leute vermehrt dort unterwegs sind, wo es wenig lawinenkritisch ist – sprich Modeskitouren. Auch der Hype der Gleitschneelawinen, mit denen auch Skigebietsbetreiber konfrontiert sind, spiegelt sich in der Statistik der Lawinentoten nicht wider. Gibt es dann doch einmal einen Peak, dann handelt es sich meist um einen Unfall mit mehreren Toten – Beispiel Martin-Busch-Hütte.
Eine Klimaindikation kann also bei den Lawinentoten nicht festgestellt werden.
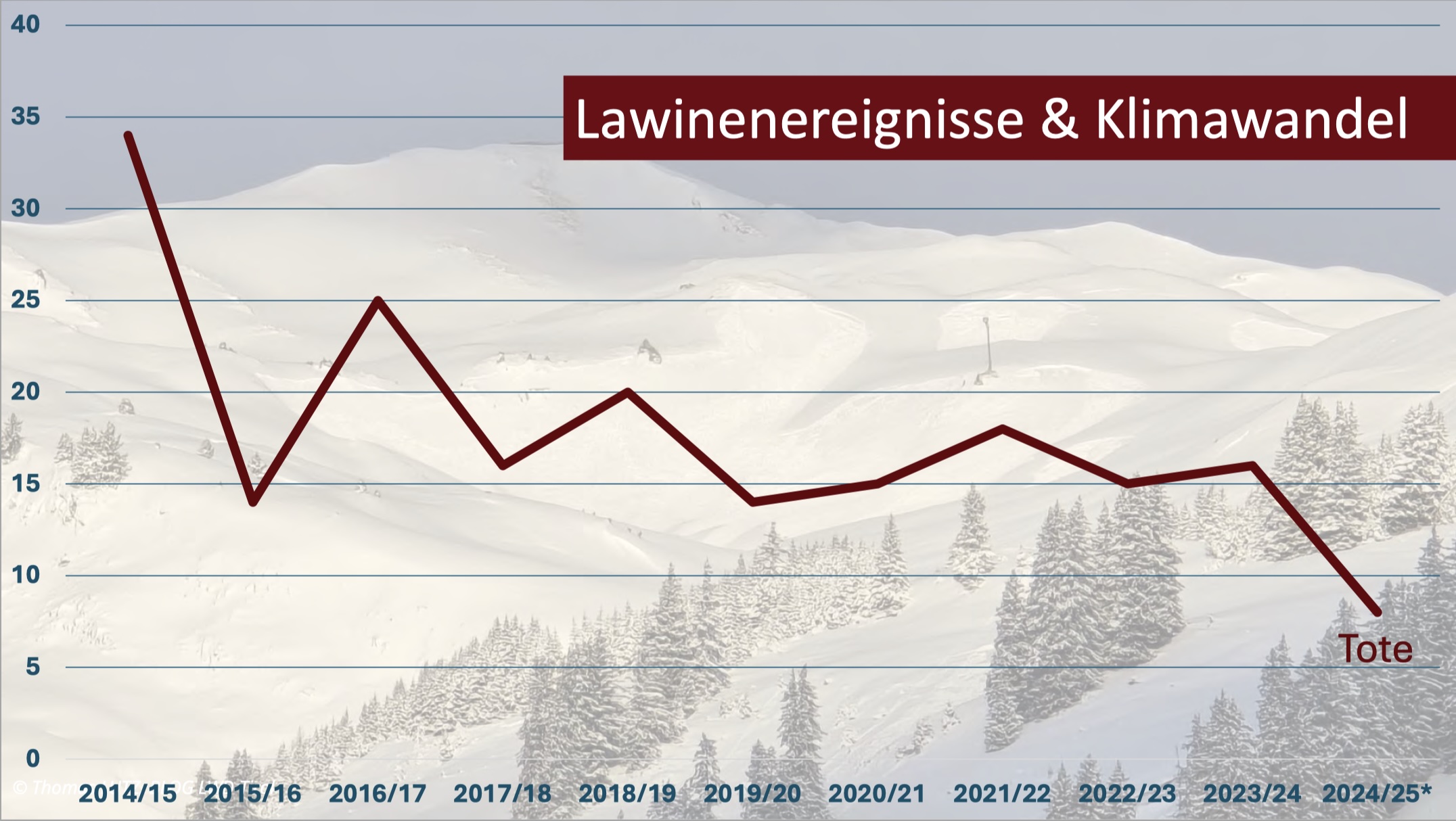
Beim Unfallbeispiel Martin-Busch-Hütte (3 Tote) zieht Gutachter Michael Larcher den tageszeitlich extremen Temperaturanstieg als Erklärung für den Lawinenunfall heran.
–> Die Analyse des Lawinenunfalls Martin-Busch-Hütte, Niedertal, durch Michael Larcher kann auf YouTube nachgesehen werden.
Der Fall wirft auch im Publikum Fragen auf:
Ob dieser tageszeitliche Temperaturanstieg im April als ein üblicher Tagesgang oder als die neue Normalität (ähnlicher tageszeitlicher Temperaturanstieg genau ein Jahr später) bezeichnet werden kann, bleibt offen. Als Gutachter gesprochen ist für Walter Würtl ein solcher tageszeitlicher Anstieg im April nicht außergewöhnlich – nicht heute und auch nicht vor mehreren Jahren. Passt man diese eine Woche im April aber in einen längeren klimatischen Zeitraum, sieht man sehr wohl, dass sich die Mittelwerte kontinuierlich nach oben verschoben haben.
Walter Siebert fragt sich und die Anwesenden, ob man denn nicht ziemlich spät dran war, um im April diese südseitig exponierten Hänge zu queren. Der Zeitpunkt des Startens spielt also sicherlich so wie immer im Frühjahr eine Rolle. Aber Jan Beutel gibt auch zu bedenken, dass es nicht nur um den tageszeitlichen Temperaturanstieg geht, sondern auch um den Schneedeckenaufbau insgesamt. Hier könne viel eher als bei der Tagestemperatur eine Klimaindikation festgemacht werden – sprich Schnee fällt am Beginn des Winters schon auf einen nicht mehr gefrorenen Boden, die Schneedecke wechselt kleinräumig von wenig und zu viel Schnee, auf eine gut ausgeprägte Schwachschicht fällt in kurzer Zeit viel Schnee etc.
Peter Plattner fügt hinzu, dass die Lawinenunfälle der letzten Jahre immer die gleichen Mechanismen aufweisen: Geländefallen, Übergang von wenig zu viel Schnee, schlechte Sammelpunkte, gemeinsam in einen Hang gefahren. In Summe kann nichts wirklich Neues festgestellt werden.
Das Verfahren wurde jedenfalls auf Basis des Gutachtens eingestellt.
Ausschlaggebend ist immer wie das Gericht und wie die Staatsanwaltschaft reagiert. Ein anderer Richter hätte durchaus auch anders entscheiden können und es wäre zu einem Strafverfahren gegen die Bergführer gekommen. Um detailliert über das Gutachten zu diskutieren, wäre es aber notwendig, Michael Larcher selbst einzuladen und zu Wort kommen zu lassen.
Skiunfälle und Klimawandel
Gibt es mehr Skiunfälle auf Pisten z. B. durch apere Sturzräume, mangelhafte Polsterungen atypischer Gefahren (Liftstützen, Schneekanonen etc.) oder insgesamt durch eine schlechtere Pistenqualität (Vereisung, wenig Ausgleich von Unebenheiten etc.)? Ein solcher Zusammenhang kann anhand der Statistik nicht festgemacht werden. Generell ist aber das Unfallgeschehen – vor allem die Zahl der Verletzten auf Skipisten sehr hoch. Und das obwohl die Zahlen des ÖKAS nur einen Bruchteil (zw. 4.000 und 5.000 Verletzte, 30 bis 38 Tote) widerspiegeln, da von der Alpinpolizei nur jene Fälle aufgenommen werden, wo es Tote gab oder der Verdacht auf Fremdverschulden vorliegt.
Atypische Gefahren sind vom Pistenbetreiber zu sichern. Hier kommt auf die Pistenbetreiber sehr wohl etwas zu. Die Matte rund um einen Schneelanze muss jedenfalls bis zum Boden reichen. Bei Vereisung (durch klimatische Sonderfälle auch unvorhersehbar) der Piste muss zwar der Skifahrer sein Fahrverhalten entsprechend anpassen, aber es obliegt auch dem Pistenbetreiber, auf Gefahrenstellen hinzuweisen bzw. die Piste eventuell zu sperren. Ein Fall im Zillertal mit einer Toten zeigt, wie schwierig eine Beurteilung sein kann – das Verfahren endete mit einem Freispruch im Zweifel für den Pistenbetreiber.
Hitze
47.690 Hitzetote in Europa im Jahr 2023, 486 Tote allein in Österreich.
„Die Zahl der Hitzetoten wird durch
den Klimawandel noch weiter ansteigen.
Hier ist der Zusammenhang eindeutig.“
Sieht man sich die ÖKAS-Zahlen der alpinen Unfallstatistik in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen an, dann ist hier ein steigender Trend zu beobachten. Theoretisch kann man hier eine Klimaindikation – sprich höhere Temperaturen – festmachen, aber für eindeutige Aussagen müssten natürlich auch andere Paramater wie allgemeiner Gesundheits- und Trainingszustand der Personen sowie die Anzahl der Personen (bei Schönwetter mehr Wanderer am Berg unterwegs) berücksichtigt werden.
–> Interessant dazu der Vortrag von Markus Thaler, Notfallarzt Christophorus 1, im Rahmen des Alpinforums 2024. Auch er berichtete von 10 bis 15 Prozent mehr Einsätzen an heißen Tagen und auch er ging davon aus, dass der ein oder andere Herzinfarkttoter eigentlich als Hitzetoter einzustufen wäre und diese Zahlen zunehmen werden.
Für Peter Plattner wirklich sehr überraschend ist vor allem der Anstieg der Herz-Kreislauf-Toten im Winter (2022/23 8 Lawinentote, 13 Herz-Kreislauf-Tote). Zusätzlich ist auch das Alter der Toten bemerkenswert – es handelt sich im Schnitt um Männer im Alter 50+.
Eine Anpassung an die aktuellen Verhältnisse – sprich an heißen Tage früh starten, ausreichend Flüssigkeit mitnehmen, die Tourenwahl an die Exposition anpassen etc., wird immer relevanter.
Herzinfarkt bei geführten Touren
Zwischen 2014 und 2024 gab es 110 Tote bei geführten Touren. 21 Prozent (23 Tote) waren Herzinfarkte bzw. med. Notfälle. Bei einer Beurteilung im gerichtlichen Verfahren ist von Bedeutung, ob die Tour auf die Verhältnisse und die geführten Personen abgestimmt war.
In Zukunft wird man als Führungsperson sicher mehr
auf diese gesundheitliche Dynamik eingehen müssen.
Die Kollegen vom Bayerischen Kuratorium forcieren das Projekt „Wandern fürs Herz“ von Birgit Böhm. Dabei können die Teilnehmer ihren Gesundheitszustand vorab testen. Die Touren werden dann genau passend auf ihren Zustand (Kondition, Kraft, Vorerkrankungen) abgestimmt. Damit können durchaus auch neue, gesundheitsbewusste Kunden gewonnen werden.
Forstunfälle und Klimawandel
Mehr Waldschäden durch den Klimawandel (Trockenstress, Stürme, Schneebruch etc.) erfordern mehr Forstarbeit, um Schadholz rasch aus dem Wald zu bringen (Borkenkäfergefahr). Arbeiten im Wald sind generell gefährlich und mit der Anzahl der klimabedingten Schadereignisse steigt auch die Anzahl der tödlichen Forstunfälle.
ZUSAMMENFASSUNG
- Klimawandel ist „Fakt“!
- Auswirkungen sind vielfältig und die Dynamik im alpinen Naturraum ist groß!
- Im alpinen Unfallgeschehen sind die Auswirkungen der Klimakrise (noch) nicht eindeutig feststellbar!
- In der gerichtlichen Beurteilung (fachlich und rechtlich) hat die Klimakrise den Berg noch nicht erreicht!

↑ Foto: Archiv Bergwacht Bayern
Besondere Herausforderungen der Einsatzleitung Bergrettung
aus juristischer Sicht
Berg- und Luftretter, Einsatzleiter; Leiter Zentralmodul Einsatzleiter-Ausbildung Bergwacht Bayern; Direktor des Amtsgerichts a. D.; 1. Vorsitzender Deutscher Gutachterkreis Alpinunfälle
SORGFALTSPFLICHTMASSSTAB IN DER BERGRETTUNG?
Zunächst: Vertragliche Verpflichtung aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem jeweiligen Zweckverband, der die Integrierte Leitstelle (Notrufannahme) betreibt, und der jeweils zuständigen Bergwacht: Die Bergwacht verpflichtet sich vertraglich, ganzjährig rund um die Uhr einsatzbereit zu sein und im Rahmen der durch die ehrenamtliche Leistungserbringung gegebenen Möglichkeiten ihre Einsatzkräfte schnellstmöglich zum Einsatz zu bringen.
Weitere Sorgfaltspflichtmaßstäbe in der Bergrettung
- Gesetz: Kein Bergrettungsgesetz! Aber: BayRDG, AV BayRDG, mittelbar ArbSchG, StVG (Sonderrecht/Wegerecht)
- Dienstvorschriften, indiziell – DRK DV 100 (Führung), Unterweisungsnachweise Luftrettung, Blaulichtbelehrung, vgl. Bergwacht „Wissensbox 2.0“
- DIN-Vorgaben, EN-Normen (z. B. Herstellung, Verwendung von Bohrhaken, Seilgarten)
- Unfallverhütungsvorschriften
- FIS-Regeln im Skibereich (Kollisionsunfälle mit Bergrettern)
- Allgemein anerkannte Bergsteigergrundsätze (Eigenregeln des Sports, Verkehrsnormen)
- nicht: Lehrmeinungen, unverbindliche Verhaltenskataloge
- nicht generell: Lehrbücher, Lehrpläne, „Wissensbox“? (Gemengelage!)
- nicht grundsätzlich: UIAA
- „Normative Maßperson“ (Verhalten eines umsichtigen, verständigen, in vernünftigen Grenzen vorsichtigen Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters)
Im Einzelnen konkret
Gesetzliche Vorgaben in der Einsatzdurchführung ergeben sich aus dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz (BayRDG) und der Ausführungsverordnung (AVBayRDG), und hier insbesondere aus dem
- Grundsatz, die am schnellsten verfügbaren geeigneten Einsatzmittel des öffentlichen Rettungsdienstes einzuplanen (Dispositionsgrundsatz ILS für Notfallpatienten, § 4 Abs. 1 Satz 1 AVBayRDG),
- aus der geforderten Personalqualifikation der Retter (vgl. § 43 Abs. 8 Satz 1 BayRDG), die wiederum eine umfassende alpine und medizinische Eignung und Befähigung voraussetzt (vgl. Prüfungsordnung der Bergwacht Bayern), und
- mittelbar aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
ArbSchG
- Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren sind zu verhüten,
- Gefährdungen zu beurteilen
- und entsprechende Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte zu ergreifen.
Für ehrenamtliche Bergretter findet das
ArbSchG keine unmittelbare,
aber mittelbare Anwendung.
Die Bergretter in Bayern sind über die Kommunale Unfallversicherung (KUVB) versichert. Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind für ehrenamtliche und notwendig unfallversicherte Einsatzkräfte rechtlich über eine Ermächtigungsgrundlage (§ 15 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII) und eine Verweisung in einer einschlägigen Unfallverhütungsvorschrift (§ 2 DGUV Vorschrift 1 [Grundsätze der Prävention]) zwingend zu beachten. Ein Verzicht auf die Vorgaben ist rechtlich nicht möglich.
Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 1 mit Erläuterungen in DGUV 100-0019) und damit Gefährdungsbeurteilungen und die daraus abzuleitenden notwendigen Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte konkretisieren die Fürsorgepflichten des Einsatzleiters für die Einsatzkräfte und sind rechtlich – als autonomes Recht der Unfallversicherungsträger – (indizieller) Sorgfaltspflichtmaßstab im Bereich der Bergrettung und insbesondere der Einsatzleitung.
- Österreich: § 176 Ab. 1 Ziff 7 lit a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – Unfälle in Ausbildung und Einsatz
- DRK (e.V.): § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII – Unfallversicherung Bund und Bahn
Die Nichtbeachtung einer Unfallverhütungsvorschrift indiziert den Sorgfaltspflichtverstoß und auch die Ursächlichkeit zwischen Verstoß und Unfall (OLG Bremen, BauR 2005, 391; OLG Stuttgart, NJW-RR 2010, 451); Gefahr hätte erkannt und der Unfall (Erfolg) vorhersehbar vermieden werden können,
- weil auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen umgesetzt worden wären und/oder
- der Einsatz abgebrochen/unterbrochen worden wäre.
Zu Dienstvorschriften: Dienstvorschriften zu entwerfen ist in Summe nicht so einfach. Auf der einen Seite müssen sie der Organisationsverantwortung genügen, die man als Führungskraft hat, andererseits dürfen sie aber auch die Bergretter vor Ort nicht zu sehr knebeln. Dienstvorschriften können verschieden formuliert werden: Sie können als Weisung (Muss-Bestimmung), als Richtlinie (soll) oder als Empfehlung (kann) ausgesprochen werden.
Als Sachverständiger sollte man sich daher die Dienstvorschriften im Detail ansehen. Man sollte die Diktion beachten: Muss, ist, soll, sollte, soll nicht, darf, darf nicht, kann, wird empfohlen… Allerdings ist die sprachliche Verbindlichkeit von Vorgaben, Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen etc. in Deutschland und wohl auch in Österreich kaum standardisiert und der Anwender ist sich meist nicht darüber im Klaren, welche juristischen Konsequenzen daraus abzuleiten sind.
Das juristische Verständnis sprachlicher Formulierungen sollte geschärft werden: In verwaltungsrechtlichen Vorschriften legt der Gesetzgeber durch „muss“ ein bestimmtes Verwaltungshandeln streng fest, während durch das Wort „kann“ häufig ein Ermessensspielraum eingeräumt wird, nach dem eine von mehreren grundsätzlich rechtmäßigen Handlungen erfolgen kann. Eine Ermessensreduktion wird durch „soll“ ausgedrückt, wonach in der Regel eine Rechtsfolge bestimmt wird, von der nur in atypischen Ausnahmefällen abgesehen werden kann.
(Nast A, Sporbeck B, Jacobs A, Erdmann R, Roll S, Sauerland U, Rosumeck S: Study of perceptions of the extent to which guideline recommendations are binding—a survey of commonly used terminology. Deutsches Ärzteblatt, Int 2013; 110(40): 663–8. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0663)
Dienstvorschriften („Muss“) sind jedenfalls ein
indizieller Sorgfaltspflichtmaßstab.
- Ein Zuwiderhandeln gegen Dienstvorschriften ist ein Beweisanzeichen dafür, dass ein Erfolg voraussehbar war, sofern die Vorschrift den konkreten Erfolg gerade verhindern wollte. (Vgl. dazu OLG Karlsruhe NStZ-RR 2000, 141 –Unfallverhütungsvorschriften, Bergepanzer)
- Entscheidend bleibt die Gesamtbeurteilung des konkreten Einzelfalls. Die Verletzung einer Dienstvorschrift muss nicht zwingend einen strafrechtlichen Sorgfaltspflichtverstoß begründen.
- Die Vorhersehbarkeit von Gefahren, die sich schon aus anderen Umständen ergibt, kann durch Dienstvorschriften keinesfalls eingeschränkt, sondern immer nur erweitert werden (OGH v. 15.3.1971 9 Os 128/70).
Auch die Verkehrsnorm – nicht schon eine (Lehr)Meinung – wird zu (indiziellem) Sorgfaltspflichtmaßstab. Voraussetzungen:
- Veröffentlichung in der alpinen Literatur
- Empfehlung der alpinen Verbände
- Langjährige Anwendung bei der alpinen Aus- und Weiterbildung
- Langjährige, unbestrittene und ständige Verwendung in der Praxis
„Gewohnheitsrecht“, vgl. BGH NJW 1980, 1219; Ermacora, bergundsteigen 3/2000, 13 ff. Weber JR 2005, 485; Weber, in Handbuch des DAV , Rn 505 mwN; Burger, SpuRt 4/2007, S. 149 ff.
Als Gutachter sollte man im Hinterkopf haben, was die Voraussetzungen einer Verkehrsnorm im Gegensatz „nur“ zu einer Lehrmeinung sind.
Wenn es weder Dienstvorschriften noch Verkehrsnormen gibt, dann ist der Sorgfaltspflicht-Maßstab die differenzierte Maßperson, ein
- umsichtiger,
- verständiger,
- in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch,
- aus dem Verkehrskreis (z. B. Einsatzleiter, Bergretter) des „Täters“.
Wie hätte dieser sich in der konkreten Lage verhalten, um Schaden zu verhindern?
HERAUSFORDERUNGEN DER EINSATZLEITUNG
A) Blockierung
Unfähigkeit, Bergtour fortzusetzen oder umzukehren, ohne wesentlich verletzt oder erkrankt zu sein.
Der SAC definiert wie folgt: „Gesund oder leicht verletzt.“ In der Schweiz/SAC sind ein Viertel aller Notfälle Blockierungen, wobei der Höchstwert bei Klettersteigen auftritt. Auch die Chiemgauer Bergwacht (insbesondere im Berchtesgadener Land) wickelt mittlerweile in den Sommermonaten durchschnittlich bis zu 15 bis 20 Prozent der Einsätze wegen Blockierung ab.
In Bayern gibt es noch keine gute Statistik zu den Blockierungen. Die Datenauswertung, Analyse und Darstellung ist aber sicher eine wichtige zukünftige Aufgabe der Sicherheitsforschung!
Blockierung/Hilflosigkeit ist in Bayern kostenrechtlich ein „Sondereinsatz“, d. h. nicht mit den Krankenkassen abrechenbar. Sobald es aber eine ärztlicher/klinischer Abklärung gibt, wird so gut wie alles – im Gegensatz zu Österreich – von der Krankenkasse übernommen.
Allgemein kann jedenfalls auch in Deutschland festgestellt werden, dass es zu einer deutlichen Zunahme der Rettung überforderter Personen kommt, freilich bei deutlicher Zunahme der Zahl an Bergsportlern.
Ablauf des Einsatzes
Der Einsatzleiter der Bergwacht wird von der Integrierten Leitstelle alarmiert, nachdem dort der Notruf 112 eingegangen ist (vgl. § 12 Abs. 3 AVBayRDG). Das Meldebild, welches von der Leitstelle übermittelt wird, stellt die erste (auch juristische) Herausforderung für die Einsatzleitung dar. Es ist oft wenig konkret, wie z. B.: „blockierte Person“, „erschöpfte Person“, „Person in Bergnot“,“ Person wünscht Auskunft“, „verirrte Person“ etc. Das kann viel bedeuten, nämlich
- zunächst unerkannt akut internistische vitale Bedrohung,
- psychologischer Notfall bis hin zu psychischer Erkrankung wie Angststörung oder Panikattacke,
- konkrete Absturzgefahr,
- Unkenntnis oder Unsicherheit über den weiteren Auf- oder Abstieg,
- nur subjektiv gefühlte Erschöpfung ohne eigentliche Bergnotlage oder gar
- fehlende Bereitschaft, weitere Anstrengung auf sich zu nehmen
Jeder Einsatz muss jedenfalls angenommen werden, da der Einsatzleiter Bergwacht öffentlich-rechtlich bestellt (§ 16 Abs. 2 AVBayRDG) ist und sich vertraglich verpflichtet hat, nach Dienstplaneinteilung den Einsatz anzunehmen. Es besteht grundsätzlich eine Garantenstellung (Schutz- und Fürsorgestellung) für die „hilflose“ Person.
Einsatzleiter entscheidet nach Annahme
- wie der Einsatz durchzuführen ist,
- ob der Einsatz zu unterbrechen ist, wegen Eigengefährdung der Einsatzkräfte (Garantenstellung gegenüber den Einsatzkräften).
Der Einsatzleiter stellt die Lage fest, bewertet diese, und setzt die Rettungskette der Lage entsprechend in Gang. Er ist verantwortlich für das weitere Einsatzgeschehen.
Gesetzliche Vorgaben in der Einsatzdurchführung ergeben sich aus dem BayRDG, und hier insbesondere
- aus dem Grundsatz (für Notfallpatienten), die am schnellsten verfügbaren geeigneten Einsatzmittel einzuplanen (vgl. § 4 Abs. 1 AVBayRDG für die ILS),
- aus der geforderten Personalqualifikation der Retter, die wiederum eine umfassende alpine und medizinische Eignung und Befähigung voraussetzt (vgl. § 26 Abs. 2 Nr.1 lit. a AVBayRDG und Prüfungsordnung der Bergwacht Bayern) und
- mittelbar aus dem Arbeitsschutzgesetz für die eingesetzten Kräfte.
Wichtig: In Bayern keine festgelegten Ausrückzeiten für bodengebunden Bergrettungsdienst.
Zentrale Fragen des „Wie“ bei Blockierungen sind dabei, ob einerseits nicht doch eine Notarztindikation (z. B. Sturz aus 3 m Höhe – ist sogar eine Schockraumindikation) vorliegt und/oder, da zeitkritisch, ein Hubschrauber einzubinden ist, also ob aus medizinischen oder insbesondere alpinen Gründen eine (zügige) Luftrettung mit situationsbedingt erforderlichem Equipment (z. B. Winde, Wärmebildkamera, System zur Handyortung etc.) in Gang zu setzen ist.
Beispiel: LG Meiningen, 3 Ns 375 Js 2491/17, in: Spengler, Rettungsmagazin März/April 2024, S. 80/81.
Ein Landrettungseinsatz mit einer psychisch sehr auffälligen Person. Der Notarzt hat keinen Body-Check durchgeführt und hat den Hergang nicht erfragt – der Patient wurde nicht in Akut-Krankenhaus, sondern in Psychiatrie eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Tatsächlich ist die Person aus 4 m Höhe abgestürzt, und es hätte von einer vital bedrohlichen Erkrankung bez. Verletzung ausgegangen werden müssen. Es kam zu einem Strafverfahren des Notarztes wegen fahrlässiger Tötung und einer entsprechenden Verurteilung.
Der Einsatzleiter wäre nur dann zur Verantwortung zu ziehen, wenn er die Notfallindikation übersehen und keinen Notarzt geschickt hätte. In diesem Fall trug dann aber der Notarzt die Verantwortung.
Hilflosigkeit und Hubschrauber-Indikation
Das am schnellsten verfügbare geeignete Einsatzmittel ist einzuplanen (Notfallpatient), vgl. § 4 Abs. 1 AVBayRDG. Die Anforderung des (Notarzt)Hubschrauber ist dann gegeben, wenn eine medizinische Indikation (Notfallpatient, Gefährdung des Patienten durch bodengebundenen Transport/Transportverlängerung) vorliegt, also ein medizinisch relevanter Zeitvorteil, oder aber auch einerettungstechnische Indikation gegeben ist (Rettergefährdung, Patientengefährdung, z. B. Absturzgefahr, ungenaue Kenntnis des Unfallortes und/oder der bodengebundenen Abtransport auch unter Berücksichtigung der Tageszeit und/oder Wetterentwicklung erhebliche Risiken beinhaltet).
Für den bayerischen Alpenraum sind nicht alle Hubschrauber ((SAR) Bundeswehr, Bundespolizei Flugdienst (Fliegerstaffel Oberschleißheim) und auch Polizeihubschrauberstaffel Bayern (Erding/Roth)), die für die Rettung herangezogen werden können, als Notfallhubschrauber mit Arztbesetzung ausgestattet, werden aber bei Bedarf neben anderen Aufgaben (Transport, Suche etc.) auch für die Rettung von Menschenleben und Vermeidung schwerer gesundheitlicher Schäden, eingesetzt, dann gegebenenfalls mit Bergwacht-Notärzten besetzt.
Beispiele schwieriger Fälle mit folgenden realen Meldebildern
- Hoher Göll – „Erschöpfter Bergsteiger will wissen, was die Rettung kostet.“
- Blausteig – „Großer schwarzer Wolf steht vor mir“
- Grünstein, Watzmann – „Rucksack ist runter gefallen, Gipfelbereich – Nordseite, Abklärung Kosten“
- 29 Wanderer am Zugspitzblatt wegen Schneefall
Angehende Einsatzleiter bei der Bergwacht
werden entsprechend geschult,
um mit solchen Fällen umzugehen.
Reagiert werden muss auf jeden Fall.
In den Sommermonaten steigen die Einsätze markant, was auch mit der leichteren Alarmierung zu tun hat – Handy. Damit ist auch die Bergwacht sofort in der Verantwortung – z.B. auch am Goldtropfsteig, ein alpiner, nicht beschilderter Steig, wo aktuell jedes Jahr Einsätze wegen „Blockierung“ durchzuführen sind.

↑ Blockierung ist eine der häufigsten Notfallursachen.
Quelle: Aus der Präsentation von Nik Burger.
B) Rote Linien im Einsatz – Einsatzunterbrechung
Aktuelle Publikation: Im Einsatz, S&K Verlag, Ausgabe 2/2025 (April 2025), S. 60 ff
Im Zweifel für die Bergretter: Rote Linien im Einsatz; aktuell bergundsteigen Sommer 2025. Autor: Dr. Klaus Burger
Beispiele
30.09.2018 – Watzmann-Ostwand
6:40 Uhr: Bergsteiger stürzt an der Eiskapelle auf dem Weg in die Watzmann-Ostwand mit abbrechendem Eis in Randkluft ab. Die Einsatzkräfte können das Opfer wegen akuter Lebensgefahr durch die labile Eisbrücke oberhalb der Unfallstelle nicht bergen. Der Einsatz wird „abgebrochen“. Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht hatte Tage später eine Verabschiedung an der Eiskapelle durchgeführt. Der Tote wurde zwei Wochen später von Schmelzwasser frei gespült.
17.09.2022 – Hochkalter
15.00 Notruf – 2.400 m abgerutscht, verletzt
Bei sehr schlechten Verhältnissen und schlechtem Wetter möchte ein Mann unbedingt den Gipfel des Hochkalter erklimmen. Im Abstieg rutscht er aus und stürzt ab. Die Retter können wegen Vereisung und einbrechender Nacht nicht zum Verunglückten aufsteigen. Bis 21.30 Uhr bestand noch Telefonkontakt zum Verunfallten, dem man aber sagen musste, dass in der Nacht und bei dem Unwetter niemand kommen wird. Der Mann verstarb schließlich. Anhaltendes, tagelanges Schlechtwetter. Nach Wetterbesserung hat man die Suche vor Ort fortgesetzt, den Verunfallten aber unter dem Schnee nicht gefunden. Erst am 13.10.2022 wurde er von einem Hubschrauber gesichtet und dann geborgen.
12.11.2023 – Gjaidsteig
Vier Bergsteiger, zwischen 25 und 27 Jahren, wollten von Mittenwald aus über den Gjaidsteig bis zum Karwendelhaus. Mittenwald- Hochlandhütte- Wörnersattel- Gjaidsteig Bäralpl-Karwendelhaus (Winterraum) gelangen. Dabei gerieten sie nicht ausreichend ausgerüstet in einen Schneesturm und kamen weder vor noch zurück. Um 16 Uhr alarmierten sie die Bergwacht über die Integrierte Leitstelle (112). Ca. 100 m vor der Gruppe musste in der Nacht wegen großer Lawinengefahr der Einsatz unterbrochen werden. Die Gruppe hatte großes Glück und konnte per HS am nächsten Morgen aufgrund eines kurzen Wetterfensterns geborgen werden.
Derartige Beispiele gibt es immer wieder, sowohl in Deutschland, in Österreich (Spaltensturz Wiesbachhorn; Hohe Munde) und auch in der Schweiz. Durch die Einsatzannahme und Einsatzübernahme obliegt dem Einsatzleiter eine Garantenstellung in zweifacher Hinsicht. Einerseits gegenüber dem Verunglückten, Verletzten oder die hilflose Person und andererseits für die von ihm eingesetzten und geführten Retter.
Von der Frage der Garantenstellung ist die Frage nach dem Umfang der Garantenpflichten zu unterscheiden. Es gibt keine expliziten Vorgaben zur konkreten Einsatzführung und zu den „roten Linien“ des Einsatzes.
Risikomanagement
Es gibt nicht wenige und auch gute Schemata, Module und Handlungsempfehlungen im alpinen Bereich, Risiken zu erfassen und zu bewerten.
In der Praxis der bayerischen Bergrettung haben sich zur Beurteilung der Gefährdungslage zwei Parameter bewährt,
- zum einen die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts
- zum anderen die Gefährdung und die Schwere des möglichen Schadens.
Eine visuell und farblich übersichtlich strukturierte Skala dient dazu, das Gefährdungsbewusstsein zu schärfen, vgl. Risikomatrix nach Nohl. Die Anforderungen an die Eintrittswahrscheinlichkeit sind dabei umso geringer, je schwerer ein möglicher Schaden wiegt. Bei möglicher Todesgefahr oder schwerer Gesundheits- oder Verletzungsgefahr muss und kann die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Gefahreintritts weit unter 50 Prozent liegen.
Die rechtliche Analyse der Gefährdung und Gefahr erfolgt dabei nach ständiger Rechtsprechung „rückwirkend“ zum Zeitpunkt der Entscheidung und nicht aus nachträglicher Schreibtischsicht, also wonach ein verständiger Einsatzleiter auf Grund der ihm erkennbaren Umstände im Zeitraum und in der Situation des Einsatzgeschehens mit all dem bekannten Zeitdruck, Entscheidungsdruck und nicht aktuell abzuklärenden tatsächlichen Umständen fällen würde.
Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen, sofern diese das Risiko vertretbar minimieren.
GKMR – Methode (vgl. Reuter/Semmel ,bergundsteigen #101 Winter 17/18 S. 98 ff; Semmel/Reuter, GKMR in der Praxis, bergundsteigen #112, Herbst 20, S. 24 ff; Hocke/Lendtrodt, Achtung Lawine, bergundsteigen #121, Winter 2022-23. S. 58 ff).
- Gefahren erkennen = Wie hoch ist die Eintretenswahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung?
- Konsequenzen abschätzen = Wie drastisch sind die Folgen?
- Maßnahmen überlegen = Welche Maßnahmen können die Eintretenswahrscheinlichkeit verringern bzw. die Konsequenzen abmildern?
- Risiko bewerten = Wie bewerte ich abschließend das Risiko unter Berücksichtigung des Risikolevels meiner Gruppe?
Anscheinsgefahr: Eine Anscheinsgefahr ist immer dann gegeben, wenn bei objektiver Betrachtung zur Zeit der Maßnahme Tatsachen auf eine drohende Gefahr hindeuten, sie aber in Wirklichkeit nicht vorliegt.
- Die Anscheinsgefahr steht rechtlich einer tatsächlich vorliegenden konkreten Gefahr gleich.
- Bei der Anscheinsgefahr liegt eine Situation vor, in der objektiv gesehen kein Schaden eintreten kann, im Moment des sicherheitsrechtlichen Handelns aber objektive Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass eine Gefahr droht. Hier sind sicherheitsbehördliche Maßnahmen solange zulässig, bis sich herausstellt, dass tatsächlich keine Gefahr vorliegt.
Spannungsfeld Eigenverantwortung des Bergretters?
- Einerseits: Fürsorge- und Schutzpflicht des Einsatzleiters für seine eingesetzten Kräfte nach den Grundsätzen des Arbeitsschutzgesetzes mit der gesetzlich vorgegebenen Weisungsgebundenheit des Bergretters gegenüber dem Einsatzleiter.
- Andererseits: Dem seit 2007 angewandten, publizierten, anerkannten und gelehrten Grundsatz in der bayerischen Bergrettung – damit bereits als Verkehrsnorm zu qualifizieren – , dass bei ausgebildeten und geprüften volljährigen Bergwachtmännern und -frauen, die ihrer Fortbildungspflicht genügen und keine gesundheitlichen oder einsatzspezifischen Mängel oder Defizite anzeigen, man grundsätzlich davon ausgehen darf, dass sie einer gefährlichen Ausbildung und einem gefährlichen Einsatz physisch und psychisch gewachsen sind, damit einer allgemein auch juristisch akzeptieren gewissen Eigenverantwortung des Bergretters in der Einsatzpraxis insbesondere unter Berücksichtigung der Einsatzdurchführung des Bergretters im Wege der Auftragstaktik.
- Die rote Linie im Einsatzablauf ist nicht die abstrakte, sondern erst die konkrete Gefahr.
- Die Entscheidung über die rote Linie kann nur in der konkret-kritischen Situation erfolgen, denn die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens hängt von den konkreten Umständen vor Ort ab.
- Daraus folgt, wie wichtig es ist, in entsprechenden kritischen Einsatzlagen hoch geeignete und befähigte Retter als Abschnittsleiter/Gruppenführer einzusetzen (Personalauswahl!), um aufgrund einer dann verlässlichen Information, Bewertung und Kommunikation die sachgerechte Entscheidung vor Ort in der konkret-kritischen Situation treffen zu können.
C) Große Beutegreifer im Einsatzgebiet
Der Bär ist aufgrund seiner Einstufung in der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders und streng geschützt.
Es gelten die Zugriffs- und Stör- sowie die Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 BNatSchG. Ausnahmen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Der Bär unterliegt nicht dem Jagdrecht. Über Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten entscheidet somit die Umweltverwaltung.
Quelle u.a. Merkur, 09.06.2023: „Die Trentiner Bergrettung hat beschlossen, wegen des hohen Risikos eines Raubtierüberfalles keine nächtlichen Einsätze mehr durchzuführen …“
Die neuen Regeln besagen, dass die Bergretter in den Gebieten, wo es Bären und Wölfe gibt, nicht mehr zu nächtlichen Einsätzen ausrücken, da es für sie zu gefährlich sei. Der Einsatzstopp gilt ab der Abenddämmerung und damit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr und gilt bis in die frühen Morgenstunden von 4 bis 5 Uhr.“ Diese Konsequenzen entsprechen in der medial vermittelten Kompromisslosigkeit nicht der deutschen und auch freilich nicht der Rechtslage im Trentin.
Für den alarmierten Einsatzleiter, der für seine Kräfte verantwortlich ist, gilt auch hier: Unfälle sind zu vermeiden, Gefährdungen sind zu beurteilen und Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen. Es ist also zu verhindern, dass Bergretter zu Schaden kommen.
Der Umfang der Schutzmaßnahmen richtet sich nach der möglichen Schwere des Schadens und dem Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, mithin der Wahrscheinlichkeit einer Bärenbegegnung und eines Bärenangriffs. Entsprechend ist das Maß der Schutzmaßnahmen zu bestimmen.
Bei einer abstrakten Bedrohungslage (Bär im Gebiet gesichtet, keine Vorkommnisse) wird man mit einem Weniger an Schutzmaßnahmen auskommen. Es kommt auf die Lage des Einzelfalls an.
- Bei einem Einsatz mit dem konkreten Hinweis auf einen Wildtierangriff oder einer Wildtierbeteiligung, z.B. „Forstarbeiter nach Bärenangriff verletzt“, sollte dringend über die Integrierte Leitstelle die Polizei verständigt werden.
- In Absprache mit der Polizei kann/ist zusätzlich ein Jäger anzufordern.
- Eigenschutz hat dabei oberste Priorität, so auch die Einsatzempfehlung der Bergwacht Bayern.
- In Bayern, und auch wohl in den anderen Bergrettungsorganisationen im Alpenraum, führen Bergretter keine entsprechenden Schusswaffen oder Abwehrmittel mit sich. Entscheidend wird dann sein, ob die Begleitung eines Polizeibeamten oder Jägers mit entsprechenden notwendigen fachlichen und schusstechnischen Fähigkeiten das Gefährdungsrisiko in vertretbarem Maße minimiert. Virulent ist eine entsprechende Begleitung in Bayern noch nicht geworden.
D) Bergwacht im Waldbrand-Einsatz
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am 27. Juli 2023 ein Konzept Katastrophenschutz Bayern 2025 vorgestellt, in dem festgehalten ist: „Die Bergwacht Bayern nimmt im Katastrophenschutz aber bisher keine eigenständige Rolle wahr. Angesichts der bei der Bergwacht bestehenden Kompetenzen kann ihr gezielter Einsatz bei Katastrophenlagen Mehrwerte bieten. Dies gilt etwa bei einer möglichen Unterstützung von Feuerwehr- und weiteren Einsatzkräften bei der Vegetationsbrandbekämpfung vorwiegend im alpinen Gelände.“
Diese Aussagen fordern die Bergrettung, sich über den gesetzlich zugewiesenen reinen Rettungsauftrag auch im unwegsamen Vegetationsbrandszenario Gedanken zur Zusammenarbeit mit den Feuerwehren zu entwickeln, und dies auch unterschwellig in Einsätzen außerhalb von ausgerufenen Katastrophenlagen oder übergeordneten Einsatzlagen wie einer Sanitätseinsatzleitung nach Art 13 BayRDG. In Konsequenz sind Konzepte zu entwerfen, entsprechende Spezialausrüstung zu beschaffen und vorzuhalten sowie Einsatzkräfte zu schulen.
Grundsätzlich ist und bleibt die Brandbekämpfung auch im Gebirge und im unwegsamen Gelände Aufgabe der Feuerwehr. Dabei gilt unter anderem im Bereich der Sicherheit und Taktik – die L-A-C-E-S Regel (sicheres Vorgehen bei Vegetationsbränden):
- Lookout (Beobachter)
- Ankerpunkt
- Communications
- Escape Route(s) Fluchtweg(e)
- Safetyzone(s) Sicherheitszone(n)
Feuerwehr und Bergwacht handeln im
gemeinsamen Einsatz grundsätzlich eigenständig.
Der Einsatzleiter Feuerwehr trägt die Verantwortung für die von ihm eingesetzten Kräfte der Feuerwehr, der Einsatzleiter Bergwacht ist für seine Bergretter-Mannschaft verantwortlich.
Dies ergibt sich aus dem BayFwG und dem BayRDG nebst jeweiligen Ausführungsvorschriften, wonach diesen Organisationseinheiten – außerhalb übergeordneter Einsatzstrukturen (SAN-EL-Lage, Katastrophenschutzlage) klare und abgrenzbare, eigenständige Zuständigkeiten zugewiesen sind:
- Für die Feuerwehr: Abwehrender Brandschutz sowie technischer Hilfsdienst.
- Für die Berg- und Höhlenrettung: Rettung verletzter, erkrankter oder hilfloser Personen aus Gefahrenlagen im Gebirge, im unwegsamen Gelände und in Höhlen.
Bergwacht im Vegetationsbrand: Nicht nur rettungsdienstliche Absicherung, sondern auch
- technische Unterstützung (Drohnen mit Wärmebildkamera, mittels Technikteam, Skywatcher; überlegene seiltechnische Fertigkeiten, z. B. Seilgeländer-Bau, Spezialmaterial)
- organisatorische Unterstützung (geländegängigen Fahrzeugen ( z.B. ATV’s) insbesondere für den Bereich der Logistik),
- personelle Unterstützung durch Spezialkräfte, z. B. Air Rescue Specialists (Luftretter), Bergwacht-Sondergruppe Umwelteinsatz mit Spezialausrüstung, Bergretter mit Geländekenntnisse …
Das Zusammenwirken von Feuerwehr und Bergwacht findet rechtlich im Rahmen der so benannten horizontalen Arbeitsteilung statt. Horizontale Arbeitsteilung fordert im rechtlichen Sinn:
- Klar definierte Zuständigkeiten.
- Wechselseitige Koordination und wechselseitige Information.
Bei komplexen und besonders gefahrgeneigten Vorhaben besteht rechtlich eine Verpflichtung zu wechselseitiger Koordination und Information.
Das Vegetationsbrandgeschehen ist eine komplexe und gefahrgeneigte Aufgabe und Tätigkeit.
Verpflichtung zu (stetiger) gemeinsamer Lagedarstellung, Lagebewertung und Befehlsgebung, auf allen Führungsebenen, bei funktionierender Kommunikation bis hin zu den untergeordneten Führungseinheiten/Einsatzkräften vor Ort im exponierten Gelände.
Thema: Sicherung von Feuerwehrkräften
Zuführung von Feuerwehreinsatzkräften durch die Bergwacht zu den Brandherden, und gegebenenfalls die Sicherung von Feuerwehreinsatzkräften bei der Brandbekämpfung im Absturzgelände mittels spezieller Seiltechnik.
- Der Bergretter trägt arbeitsteilig eine Mitverantwortung für die Rückzugsmöglichkeit der zum Brandherd geführten Feuerwehrkräfte.
- Für eine Gefährdungsbeurteilung „Waldbrandgeschehen“, insbesondere vor Ort, fehlt es dem Bergretter regelmäßig an der gebotenen Risiko- und Sachkenntnis.
- Schutzmaßnahmen der Bergrettung für den in jeder Lage ungehinderten Rückzug der Feuerwehrkraft, insbesondere bei dramatischer Lageänderung, sind nicht in ausreichendem Umfang zu garantieren:
- Keine wirklich feuerfesten Seile,
- und gegebenenfalls ist auch ein (schnelles) Abrücken der Bergwachtkräfte wegen Eigengefährdung notwendig.
Rechtlich nicht haltbar ist es dabei, die Feuerwehrkräfte nach entsprechender Lagevermittlung dem Rechtsinstitut der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung zu unterwerfen, und damit die arbeitsteilig mitwirkenden Bergretter von strafrechtlicher Verantwortung oder zivilrechtlicher Haftung im Unglücks- und Schadensfall „freizustellen“:
- Feuerwehrkräfte haben keine Gefährdungsherrschaft über das verwendete Seil- und Sicherungsmaterial, und sie sind – jedenfalls derzeit – nicht in organisierter und behelfsmäßiger Seiltechnik ausgebildet, mithin fehlt es an der Handlungsfähigkeit in tatsächlicher Hinsicht.
- Eine rechtfertigende Einwilligung der Feuerwehrkräfte in eine konkrete Eigengefährdung oder gar Todesgefahr ist nicht zu unterstellen.
Die obigen Ausführungen betreffen zunächst die Lagen außerhalb rechtlich übergeordneter Führungsstrukturen, also Lagen, in denen Feuerwehr und Bergwacht ohne gegenseitige Weisungsbefugnisse agieren.
Bei gesetzlichen übergeordneten Führungsstrukturen
- wie der Alarmierung einer Sanitätseinsatzleitung
- oder einer Einsatzleitung im ausgerufenen Katastrophenfall
gilt ebenfalls, dass Information und Kommunikation zwischen den Einheiten der Führungsebenen gewährleistet sein müssen, wenn eine arbeitsteilige und insbesondere gefahrgeneigte Aufgabenbewältigung zugewiesen ist.

↑ Bergwacht im Feuerwehreinsatz.
Quelle: Aus der Präsentation von Nik Burger.
E) Bergrettung wider Willen
(vgl. Burger, bergundsteigen Sommer 2021 / #115, Wie viel Unvernunft darf sein?, S. 24 ff)
Die Bergrettung steht im Spannungsverhältnis zwischen der Garantenstellung des alarmierten Retters für den Hilfsbedürftigen einerseits und andererseits dem Recht auf eigenverantwortliche Selbstgefährdung des Bergsteigers als Ausfluss seines verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechts. Zwangsmaßnahmen sind aber grundsätzlich auch am Berg der Polizei vorbehalten. Falls die Bergrettung am Berg die Verweigerung einer Hilfe, die aus dortiger Sicht notwendig ist, akzeptiert und abrückt, bewegt sie sich auf rechtlich dünnem Eis, sofern dann doch Hilfe notwendig ist und sich herausstellt, dass der Betroffene seinen Willen eigentlich nicht mehr frei bestimmen konnte.
Die Rechtslage ist komplex, um nicht zu sagen kompliziert: Dies beginnt schon mit unterschiedlich rechtlichen Begrifflichkeiten und Inhalten wie
- eigenverantwortliche Selbstgefährdung im Strafrecht,
- Handeln auf eigene Gefahr im Zivilrecht,
- Einwilligungsfähigkeit insb. für invasive med. Eingriffe (Zivilrechtund Strafrecht),
- freie Willensbestimmung im Betreuungs- und Unterbringungsrecht (vgl. §§ 1814 Abs. 2, 1832 Abs. 1 Nr. 3, 1831 BGB) und
- autonom gebildeter freier Wille – als Ausdruck des jüngst vom Bundesverfassungsgericht benannten Rechts auf selbstbestimmtes Sterben (BVerfG v. 26.02.2020).
Dass diese komplexen Rechtsvoraussetzungen zur Eigenverantwortung bis hin zu den Voraussetzungen zum Recht auf Suizid dem Bergretter in steiler Wand oder bei widrigsten Wetterverhältnissen weniger hilfreich sind, liegt auf der Hand. Psychiater, Staatsanwälte oder und Strafverteidiger sind nicht vor Ort, um lagebedingt sind oftmals schnelle Entscheidungen zu treffen. Wie ist also zu entscheiden und wie ist zu handeln? Was ist die Rolle der Polizei?
Polizeilicher Platzverweis (kann auch telefonisch/per Funk erteilt werden):
- Nicht das Rettungsdienstrecht, sondern das Polizeirecht eröffnet explizite Zwangsbefugnisse, eine Person aus einem Gefährdungsbereich zu schaffen. Befugnisnorm der Polizeibeamten ist in einschlägigen Fällen die Platzverweisung, in Bayern Art. 16 Polizeiaufgabengesetz (PAG).
- Der Platzverweis ist ein verfassungsrechtlich zulässiger Eingriff in das Grundrecht der körperlichen Bewegungsfreiheit. Maßgeblich ist die Notwendigkeit der Gefahrenabwehr, also zur Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben, wobei im alpinen Gelände wegen der örtlich oftmals übergreifenden Gefährdungslage grundsätzlich auch die Richtung des Entfernens vorgegeben.
- Durchsetzung mit unmittelbarem Zwang.
- Die Eingriffsmaßnahmen stehen dabei im pflichtgemäßen Ermessen der Polizei und unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Für den Bergretter gilt:
Es gibt keine entsprechende
(hilfsweise) Anwendung des Polizeirechts.
Zwangsmaßnahmen des Bergretters können aber über § 34 StGB gerechtfertigt sein. Danach ist gerechtfertigt ist, wer in Kenntnis einer Notstandslage ein Interesse (Freiheit, körperliche Unversehrtheit) eines Dritten schädigt, um ein wesentlich überwiegendes eigenes oder fremdes Interesse zu erhalten. Die Rechtsgüter sind abzuwägen (z. B. Leben der Retter versus Freiheitseinschränkung des sich Weigernden), und die Notstandshandlung muss ein angemessenes Mittel sein, die Gefahr abzuwenden. § 34 StGB ist dogmatisch keine Eingriffsbefugnis-Norm, sondern lediglich ein Rechtfertigungsgrund.
Der Schlüssel, um die Thematik Zwangsrettung für den Bergretter praktikabel handzuhaben, liegt in der Kombination der zwei Fragen:
- Besteht eine erhebliche Eigengefährdung des sich Weigernden?
- Wird die Entscheidung des sich weigernden Gefährdenden eigenverantwortlich in freier Willensbestimmung getroffen?
Optimal, insb. rechtlich, wäre in entsprechenden Fallgestaltungen die Kombination aus medizinischem Sachverstand (Arzt, gegebenenfalls auch über Funk) und polizeilichem Platzverweis (Polizei, auch über Funk möglich).
„Checkliste“ Verweigerung der Hilfe im
- Freie Willensbestimmung, ja oder nein? Dokumentation!
- Wenn Verdacht auf „nein“: Psychiatrische Indikation? – Arzt ggfs auch über Funk!
- Falls keine freie Willensbestimmung und erhebliche Eigengefährdung: Zwangsbefugnisse? – Polizei einbinden, ggfs über Funk! (Platzverweis, Schutzgewahrsam, Sicherungsgewahrsam).
- Rechtfertigung Bergretter ohne polizeiliche Maßnahme: „Nur“ rechtfertigender Notstand, § 34 StGB (äußerstes Mittel).

Lawinenunfall beim Graben von Schneehöhlen
im Zuge einer militärischen Ausbildung
Peter Gayer
ehem. Präsident IVBV – SV Bayern
Bei dem Unfall handelt es sich um einen Lawinenunfall, der etwas abweicht von herkömmlichen Unfallereignissen. Dies ist der speziellen Situation, insbesondere den hohen Anforderungen an die Schneedecke und deren Beurteilung, geschuldet. Der Unfall zeigt auch auf, dass in manchen Situationen das vermeintlich „Richtige“ lt. Lehrplan bzw. Vorschrift nicht ausreicht und folglich einen Schritt darüber hinausgedacht werden muss.
UNFALLHERGANG
1. Ausgangssituation
Ausbildungsort
Als Ort zum Bau von Schneeunterkünften wurde ein markanter Windkolk am Daunkogelferner, unterhalb des Grates zwischen Östlichem Daunkogel 3.30 m und Stubaier Wildspitze 3.341 m gewählt. Der Kolk war dem leitenden Heeresbergführer von früheren Ausbildungen bekannt. Der Aufstieg erfolgte über das Skigebiet Stubaier Gletscher, mit Ski von der Seilbahnstation „Eisgrat“ über den „Rotadel“ zum Daunkogelferner.
Personelle Zusammensetzung
Bei der Ausbildung bzw. dem Lawinenunfall waren insgesamt 19 Soldaten einer Gebirgsjägerkompanie aus Mittenwald beteiligt:
1 Heeresbergführer (fachliche Leitung)
6 Hochgebirgsspezialisten
2 Gebirgsausbilder
10 Soldaten mit alpiner Ausbildung, jedoch ohne weiterführende alpine Führungsqualifikation
Unter den Teilnehmenden befand sich auch der Kompaniechef.
Ziel der für 3 Tage geplanten Ausbildung
Herstellen eines einheitlichen Ausbildungsstandes des Führungskaders:
- In der Lawinen-Verschüttetensuche
- Der Spuranlage beim Marsch mit Ski
- Im Bau von Schneeunterkünften, zum Überleben im winterlichen Hochgebirge (Schneehöhlen in einem Windkolk)
Verhältnisse am Unfalltag Lawinenlage
- Gefahrenstufe 2, oberhalb der Waldgrenze
- Lawinenprobleme: Altschneeproblem durch kantig aufgebaute Schwachschichten, Exposition W über N bis O und Triebschneeproblem, alle Expositionen
–> Schlagzeile: Vorsicht vor Triebschnee und schwachem Altschnee!
Wetter
Bis mittags stark bewölkt und leichter Schneefall bei starkem Wind. Im weiteren Tagesverlauf zunehmende Wetterbesserung.
2. Beurteilung des Windkolks und der Schneedecke durch den Heeresbergführer
Nach Erreichen des Ausbildungsortes beurteilte der Heeresbergführer das Gelände mit dem ihm schon bekannten Windkolk. Die orografisch linke Seite war nach Süden ausgerichtet, ca. 10 Meter hoch, bis zu 43° steil und größtenteils überwechtet. In dieser Flanke sollten die Schneehöhlen gegraben werden.
Durch ein Abschreiten mit Ski, verschaffte sich der Heeresbergführer einen Überblick über das Ausbildungsgelände. Anschließend führte er in der späteren Unglücksflanke einen „Kleinen Blocktest“ durch.
Ergebnis des „Kleinen Blocktests“:
- gestufter Bruch in 30 cm Tiefe:
- bei starkem Klopfen.
Aufgrund der Informationen aus dem Schneedeckentest sowie dem Gesamteindruck über das Gelände kam der Führer zu der Einschätzung, dass die Möglichkeit einer Schneebrettauslösung unwahrscheinlich und das Gelände sicher ist.
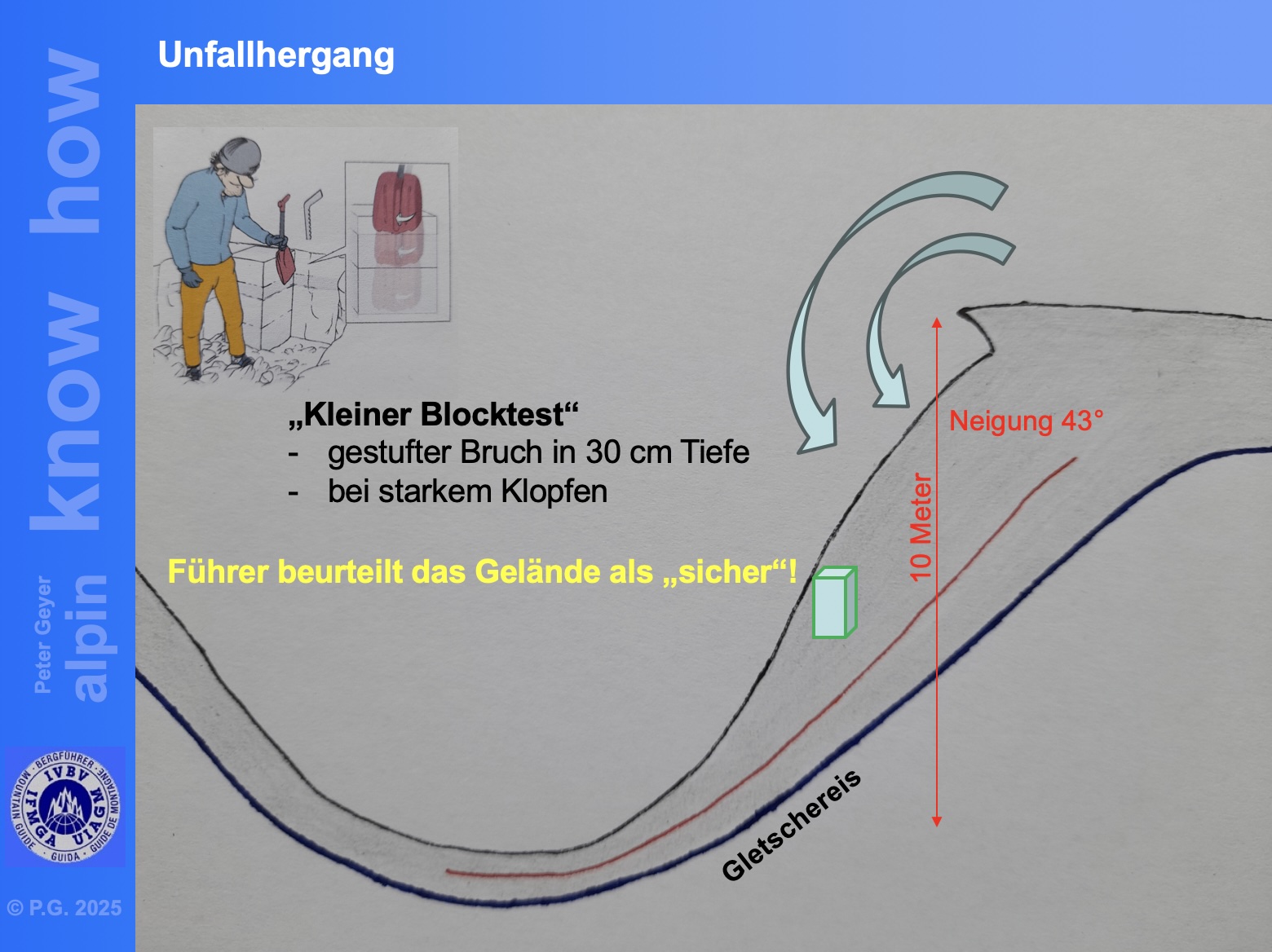
↑ „Kleiner Blocktest“ zur Beurteilung der Schneedecke.
Quelle: Aus der Präsentation von Peter Gayer.
3. Graben der Schneehöhlen
Der Führer ordnet, um ca. 12:00 Uhr den Bau von insgesamt 8 Schneeunter-künften (7 Zweierteams, 1 Dreierteam) in einem von ihm ausgewiesenen und spaltenfreien Bereich an. Während des Grabens meldet ein Soldat dem Führer, dass er auf eine harte Schicht und Becherkristallein 1,50 Meter Tiefe gestoßen ist.
Auf diese Meldung wurde,
aus welchem Grund auch immer, nicht reagiert!
4. Auslösung und Abgang des Schneebrettes
Um ca. 13:00 Uhr, kurz vor Fertigstellung der Schneehöhlen, löste sich eine Schneebrettlawine mit einer Breite von etwa 30 Meter und einer Länge von ca. 10 Meter. Anbruchhöhe bis 1,80 Meter.
Es befanden sich 16 Soldaten im Bereich der Lawine, wovon sich 14 Soldaten in den Schneehöhlen und zwei Soldaten im Außenbereich befanden. Durch die abrutschenden Schneemassen wurden die Höhleneingänge verschüttet, nur ein Höhleneingang wurde nicht vollständig verschlossen.
Schadensausmaß
- 2 ganzverschüttete Personen (in über 1 Meter Tiefe);
- mehrere teilverschüttete Personen
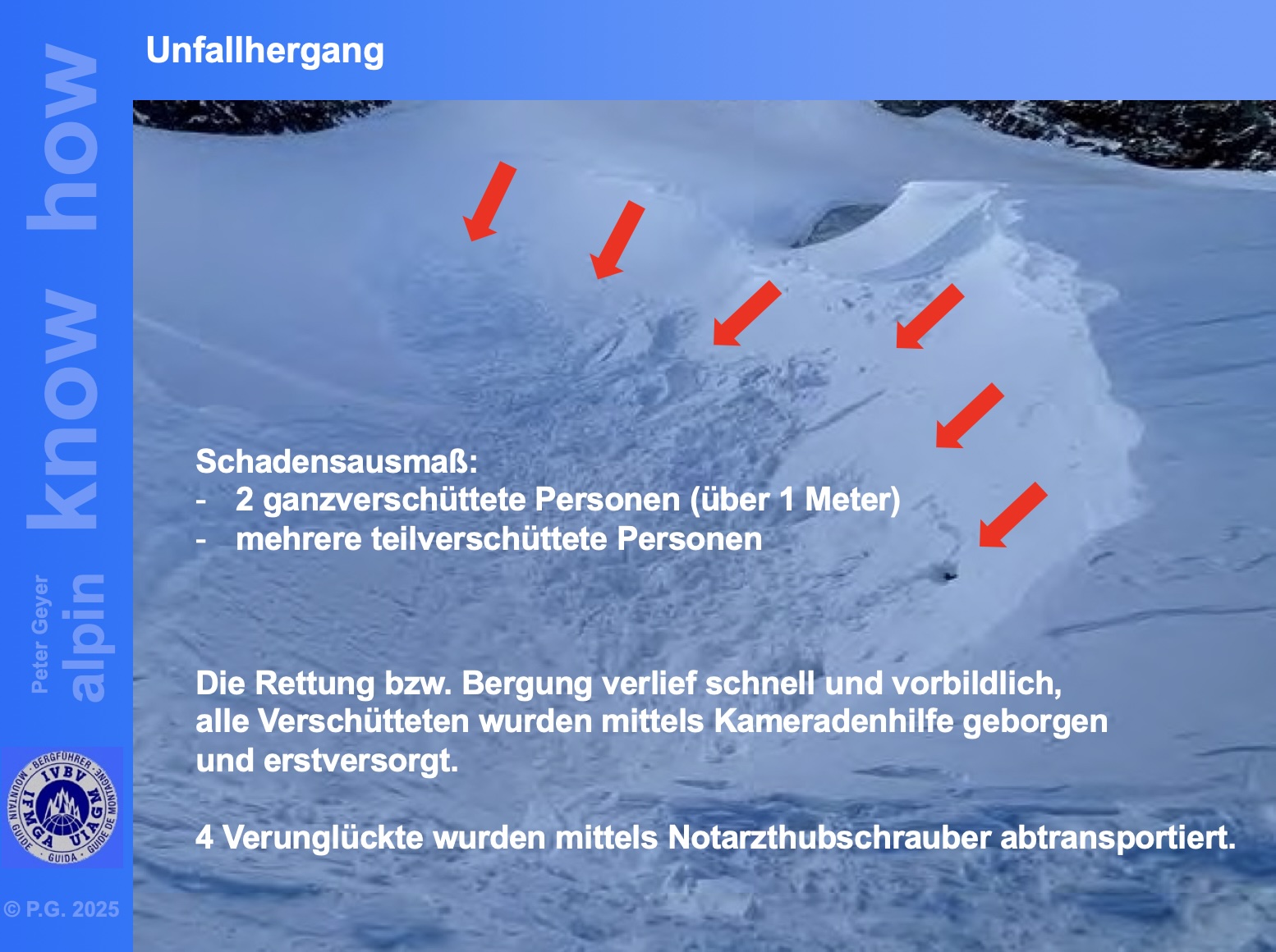
5. Verschüttetensuche und Bergung
Nach dem Schneebrettabgang wurde unter der Leitung des Führers unverzüglich die Suche nach den Verschütteten und deren Bergung aufgenommen. Schnell und vorbildlich konnten alle Verschütteten innerhalb von 10 Minuten geborgen und anschließend erstversorgt werden.
Um ca. 13:10 Uhr setzte der Kompaniechef einen Notruf ab. Mit einem Rettungshubschrauber wurden 4 Personen abtransportiert.
Was das Schadensausmaß betrifft, kann von „Glück im Unglück“ gesprochen werden. Ein absolutes „worst case szenario“ ist ohne große Fantasien vorstellbar (z.B. Abgang des Schneebrettes in der Nacht, wenn alle Soldaten in den Schlafsäcken liegen).
STRAFVERFAHREN STAATSANWALTSCHAFT INNSBRUCK
Einleitung eines Strafverfahrens gegen den leitenden Heeresbergführer wegen des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung nach § 88 Abs. 1 StGB und der fahrlässigen Gemeingefährdung nach § 177 Abs. 1 StGB.
1. Sachverständigengutachten, wichtigste beurteilende Aussagen
Zum beschuldigten Heeresbergführer:
- ausgewähltes Gelände, hier Windkolk, ist nur sehr eingeschränkt geeignet;
- Fehleinschätzung bei der Beurteilung der Schneedecke, durch nur einen Blocktest;
- warum der Beschuldigte auf kritische Rückmeldungen, hier Meldung einer harten Schicht und Schwimmschnee, nicht sofort entsprechend reagierte, ist für den SV nicht nachvollziehbar;
- eine ausgezeichnete Leistung hat der Beschuldigte bei den Rettungs-arbeiten erbracht.
Zur militärischen Struktur:
- sehr nachteilig die Gruppengröße (18 Personen) im „zivilen Kontext“ zwei oder drei Bergführer erforderlich;
- dass kritische Rückmeldungen nicht in konkrete Handlung mündeten, führt der SV auf fehlende Ressourcen des Beschuldigten zurück;
- Fehler und Fehleinschätzungen des Beschuldigten sieht der SV in der ungünstigen Organisationsstruktur und der damit einhergehenden „permanenten Überbelastung“.
Aus meiner Sicht fällt die Beurteilung des
beschuldigten Heeresbergführer eher „moderat“ aus,
während die militärische Organisation weitaus mehr belastet wird.
2. Ausgang des Strafverfahrens
Das Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung wurde mittels Diversion beendet.
- keine formelle Verurteilung;
- kein Schuldspruch;
- Zahlung eines Geldbetrages;
- Kostenübernahme durch den Beschuldigten.
RISIKOMANAGEMENT
Hier: Beurteilung der Schneedecke in der speziellen Situation.
Als ich in beratender Funktion in den Fall involviert wurde, kursierte im personellen Umfeld der Unfallbeteiligten bzw. in militärischen Kreisen völliges Unverständnis über die juristische Entwicklung des Geschehens.
„man hat doch alles richtig gemacht“
„gemäß der Vorschrift ist doch nichts falsch gemacht worden“
„es kann doch nicht sein, dass man jetzt dem Heeresbergführer einen Strick drehen will“
Diese Ansicht wurde, gleich in welcher Führungsebene, mit Überzeugung vertreten. Bei einer, durch privaten Kontakt vereinbarten Besprechung mit dem Brigadekommandeur wurde ich gebeten, meine Sichtweise zu dem Unfall darzustellen bzw. zu erörtern.
Meine Aussagen bezüglich des Risikomanagements, die zum Umdenken anregten:
- Für die spezielle Situation reichte das „Richtige nach Vorschrift“ nicht aus.
- Die Anforderungen an die Schneedecke wurden unterschätzt bzw. nicht beachtet.
- Bei der Beurteilung war mit Sicherheit die Kleinräumigkeit des zu beurteilenden Geländes ein entscheidender Faktor.
Diese Kleinräumigkeit erwies sich hierbei als Geländefalle.
Beurteilung der Schneedecke beim Graben von Schneehöhlen in Windkolks bzw. steilen Geländestufen
Eine solide Beurteilung der Schneedecke beim Graben von Schneehöhlen im steilen Gelände setzt die Erkenntnis voraus, dass es sich hier um eine spezielle Situation handelt, in der die Schneedecke ungleich höherer Belastung als beim Begehen bzw. Befahren ausgesetzt wird.
Primäre Voraussetzungen an die Schneedecke
- ausreichende Mächtigkeit der Schneedecke
- eine durchgehend homogene Schneedecke, die sehr großen Belastungen auch in der Tiefe standhält.
Relief der Schneedecke
Aufgrund der Ablagerungen durch die Windverfrachtung kann davon ausgegangen werden, dass die Leeseite des Kolks, was die Mächtigkeit der Schneedecke betrifft, begünstigt ist.
Charakteristik
- Bereiche von viel Schnee zu weniger Schnee auf engem Raum;
- bedeutet aber auch, dass mögliche Schwachschichten in variabler bzw. unterschiedlicher Tiefe liegen können.
Belastung der Schneedecke durch das Graben von Schneehöhlen
Die Schneedecke wird durch das Graben von Schneehöhlen sehr großen Belastungen, bis in tiefe Schichten, ausgesetzt. Einerseits durch das „Herumtrampeln“ der Grabenden zu Fuß und andererseits, wenn die Höhlen selbst bis in tiefe Schichten reichen.
- Belastung der Schneedecke ist ungleich größer als beim Begehen bzw. Befahren mit Ski;
- die Schwachschichten werden regelrecht „gescannt“!
- Die Erkenntnis, dass beim Graben von Schneehöhlen die Schneedecke sehr hohen Belastungen bis in die Tiefe ausgesetzt wird, ist ein entscheidender Faktor und muss bei der Beurteilung zwingend berücksichtigt werden.
Beim gegenständlichen Unfall, haben 18 Personen, 8 Schneehöhlen auf engem Raum gegraben und die Schneedecke in hohem Maße „traktiert“.
Schneedeckentests zur Beurteilung der Schneedecke
In der Bundeswehr bzw. in der Ausbildung zum Heeresbergführer werden die beiden Schneedeckentests Exendet Column Test (ECT) und Kleiner Blocktest (KBT) als die maßgeblichen Methoden ausgebildet. Mit beiden lässt sich eine Aussage zur lokalen Schneedeckenstabilität ableiten.
Grundsätzlich sind Schneedeckentests wie der KBT oder ECT Methoden, die Aufschluss über die Belastbarkeit der Schneedecke im Wintersportbereich bzw. für das Begehen und Befahren eines Hanges geben können. Aufgrund der erfahrungsgemäß möglichen Belastung und Druckverteilung beim Begehen und Befahren, wird bei den Tests eine Tiefe von 1 Meter propagiert.
Beim gegenständlichen Unfall führte der Heeresbergführer einen kleinen Blocktest im Bereich der späteren Schneehöhlen durch.
Das positive Ergebnis ließ ihn auf eine gute Schneedeckenstabilität schließen sowie eine Lawinenauslösung als unwahrscheinlich einzustufen. Obwohl bei einem positiven Ergebnis ein Test, lt. allgemeiner Lehrmeinung, nicht ausreichend ist, verzichtete er auf weitere Tests.
In dieser, eher speziellen Situation, zwingt sich jedoch die Frage auf, ob mehrere Tests ein anderes Ergebnis gebracht hätten. Mit etwas Glück bzw. Zufall vielleicht, dies sind jedoch unzuverlässige Partner!
„Was also tun?“
Frage: „Was suche ich wo und wie in einer Schneedecke, die großen Belastungen auch in der Tiefe standhalten muss“!
Fazit:
- Kleiner Blocktest bzw. ECT sind nur sehr eingeschränkt geeignet um die nötigen Informationen über die Schneedecke zu bekommen;
- Informationen über die gesamte Höhe der Schneedecke sind erforderlich.
Mögliche Lösung:
- Graben eines Schichtprofils über die Höhe der gesamten Schneedecke;
- zusätzlicher Rutschblock kann Gewissheit schaffen.
Ein Schneeprofil bis zum Boden gibt Aufschluss über den gesamten Schichtaufbau der Schneedecke, mögliche Schwachschichten können dabei erkannt und analysiert werden.
Geländewahl für das Schneeprofil + Rutschblock:
- Möglichst im unteren Bereich des zu beurteilenden Hanges (erfahrungsgemäß geringere Schneehöhe);
- Risikoabwägung vor dem Graben des Profils (entscheidend ist die identische Exposition zum beurteilenden Bereich).
„Offene Fragen“
Während des Grabens der Schneehöhlen wurde von einem Soldaten in 1,50m Tiefe eine Schwachschicht in Form einer harten Schicht mit darunter liegenden Becherkristallen erkannt. Diese Wahrnehmung gibt er auch an den leitenden Heeresbergführer weiter.
Warum wurde hier nicht unverzüglich entsprechend reagiert?
Und/oder:
Warum reichte dem Heeresbergführer bei der Beurteilung der Schneedecke ein Test aus?
Das: „a geht scho – passt scho“ kennen alle und ich bin mir sicher, dass jeder von uns zig Beispiele aus eigener Erfahrung nennen kann. Dass jedoch bei einem „passt scho“ die getroffene Entscheidung nochmals hinterfragt bzw. die Situation bezüglich des Risikos neu beurteilt wird, setzt dafür einen Anstoß oder ein Zweifeln voraus.
Nachvollziehbar?
Das subjektiv empfundene Gefühl der Sicherheit durch die Kleinräumigkeit des Geländes, das sich später als Geländefalle erwies, ließ den Führer nicht daran zweifeln, dass die Auslösung einer Lawine unwahrscheinlich bzw. das Risiko dafür zu vernachlässigen ist.
Die Qualität unserer Entscheidungen ist maßgebend,
welchem Risiko sie letztendlich gewachsen ist!
Warum ein „passt scho“ nicht mehr negative Auswirkungen auf unsere Sicherheit haben, liegt vermutlich daran, dass wir uns meist in einem Risikobereich mit verzeihender Fehlertoleranz bewegen.
Fazit Risikomanagement
Grundsätzlich kann im Bereich Risikomanagement, hier Beurteilung der Schneedecke beim Graben von Schneehöhlen, schnell etwas verbessert bzw. Optimiert werden – zumindest in der Ausbildung.
Voraussetzung dafür ist jedoch:
- Die Erkenntnis, dass in dieser speziellen Situation die Belastung auf die Schneedecke überaus groß sein und bis zum Boden reichen kann!
- Die Beurteilung der Stabilität die gesamte Schneedecke umfassen muss und die Methode der Schneedeckentests dies auch gewährleisten kann!
- Die Erkenntnis, dass „Geländefallen“ überall lauern können. Insbesondere dort, wo Kleinräumigkeit ein Gefühl von trügerischer Sicherheit vermittelt und ein warnendes Bauchgefühl eliminiert.
Im Ernstfall bzw. in Notsituationen müssen nach einer Risikoabwägung die Prioritäten entscheiden, welcher zeitlicher und körperlicher Aufwand für die Beurteilung der Schneedecke aufgewendet werden kann.
KRISENMANAGEMENT
Aus dem Anlass, dass bei dem gegenständlichen Unfall das Krisen-management nicht nur versagte, sondern schlichtweg nicht vorhanden war, wurde bei der Aufarbeitung auch dieses Defizit zum Thema.
Durch mangelhaftes oder fehlendes Krisenmanagement wird nach einem Unfall oft viel „Geschirr zerschlagen“. Ein bis ins Detail ausgearbeiteter Notfallplan ist für ein effizientes Handeln im Krisenfall unabdingbar.
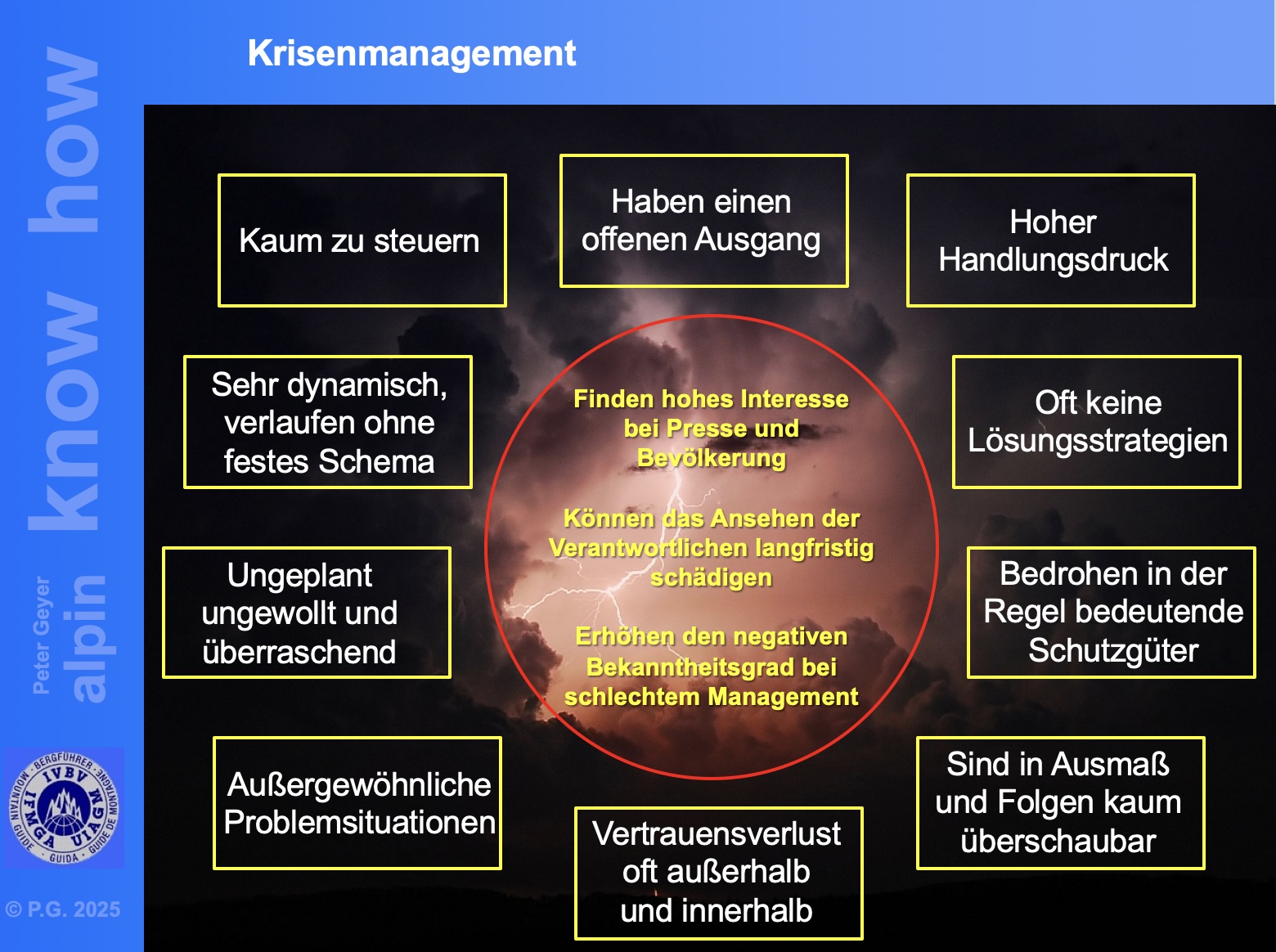
Zielsetzung: „Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun“!
- Bestmögliche Unterstützung und professionelle Hilfe für alle Beteiligten in jeder Phase.
- Abwendung und Vermeidung zusätzlicher Imageschäden (auch für den verantwortlichen Veranstalter).
Kernpunkte eines Notfallplans
- Bis ins Detail ausgearbeiteter Notfallplan, klar und übersichtlich nach Priorität strukturiert.
- Für alle Situationen offen, flexibel und effizient (Watzmann – Montblanc – im hintersten Winkel von …).
- Festgelegter „Kern“ eines Krisenstabes ist eingearbeitet, erweiterbar nach Situation und Bedarf.
- Vorbereitete Listen von Kontaktpersonen bzw. Organisationen (alle Einsatzregionen umfassend).
- „Abarbeitung“ von vorbereiteten Checklisten zur Orientierung.
Möglicher grober Leitfaden bzw. Schema eines Krisenmanagements
Zur Bewältigung einer Krise ist eine professionelle Unterstützung überaus empfehlenswert. Spezielle Versicherungen, mit wählbaren bzw. abrufbaren Leistungsmodulen, ist größeren Veranstaltern sowie Berufsverbänden anzuraten.
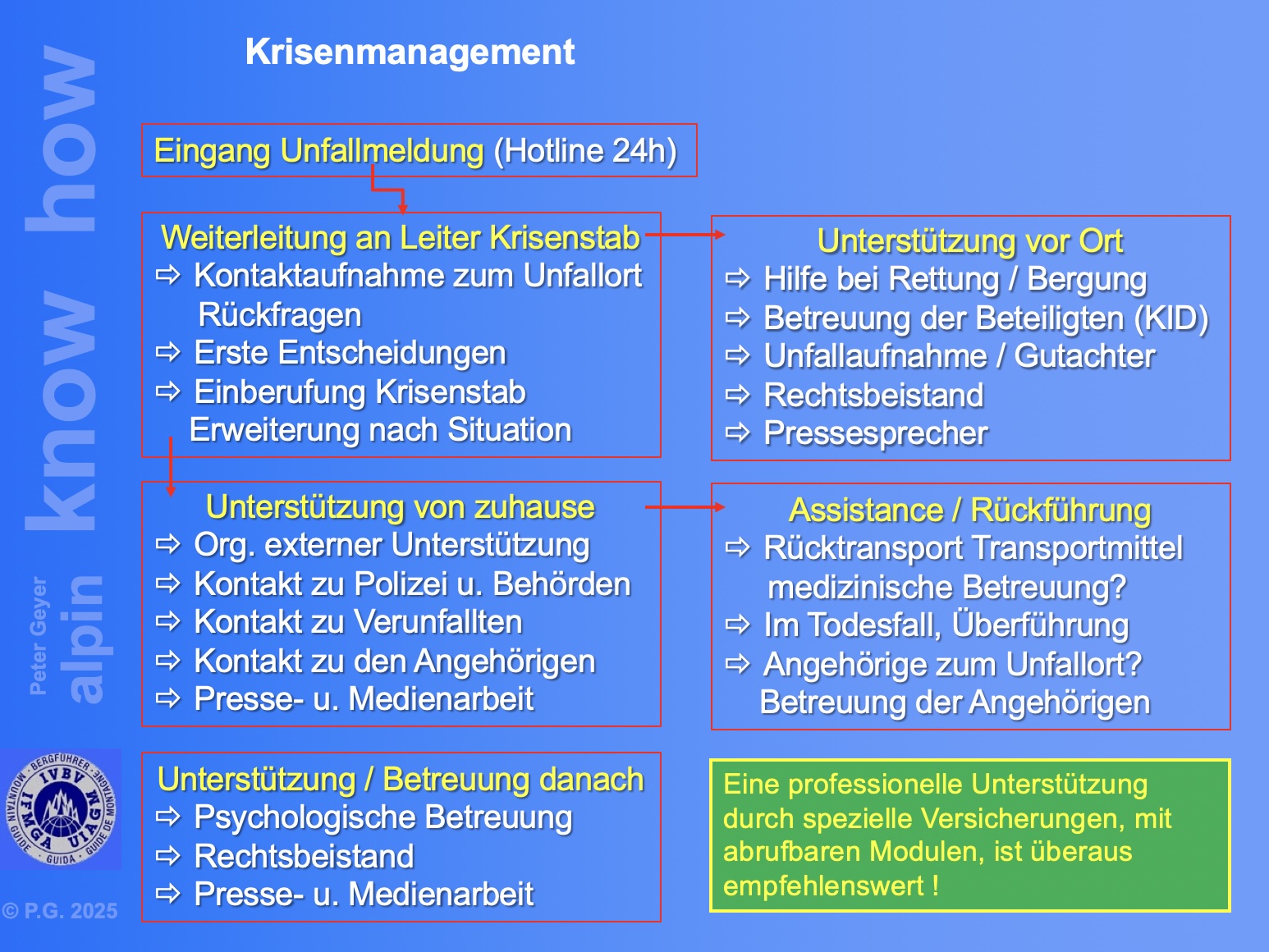
Fazit Krisenmanagement
- Nur ein vorher bis ins Detail ausgearbeitetes Krisenmanagement kann professionelle Hilfe und Unterstützung leisten!
- Mit berechtigter Selbstverständlichkeit wird von den Führern/Mitarbeitern professionelle Arbeit eingefordert.
Es sollte auch selbstverständlich sein, dass der Veranstalter bzw. der Dienstherr bei einem Unglück bestmögliche Unterstützung und Hilfe durch ein professionelles Krisenmanagement leistet. Dies schon aus eigenem Interesse zum Selbstschutz und gegen drohenden Imageverlust. Vertrauen beruht nun mal auf Gegenseitigkeit!
„Der beste Zeitpunkt, um den zukünftigen
Plan auszubrüten, ist jedoch nicht heute,
sondern gestern“!
Links & Publikationen:
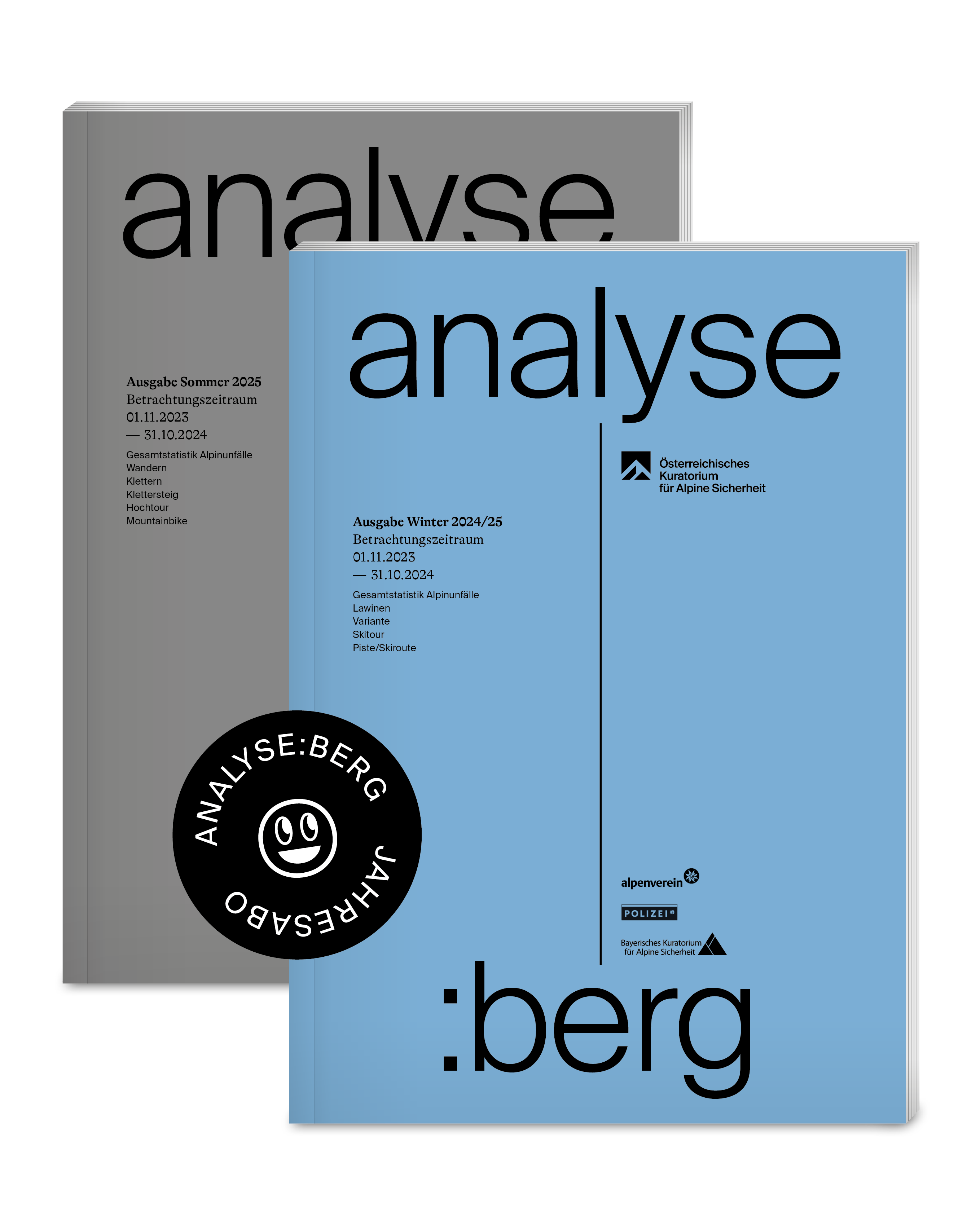
- Abo Magazin analyse:berg Winter & Sommer
- Alpin-Fibelreihe des Kuratoriums
- Alpinmesse / Alpinforum 2024
- Kontakt ÖKAS:
Susanna Mitterer, Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Olympiastr. 39, 6020 Innsbruck, susanna.mitterer@alpinesicherheit.at, Tel. +43 512 365451-13
”