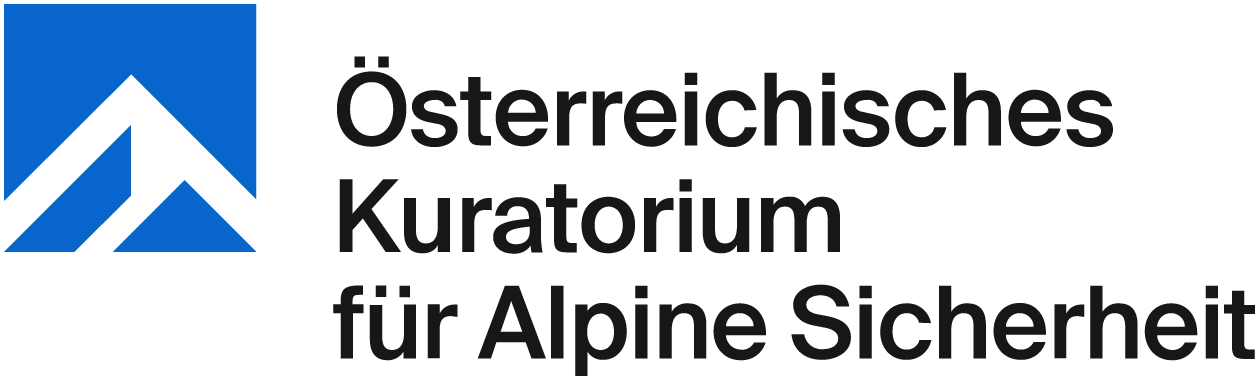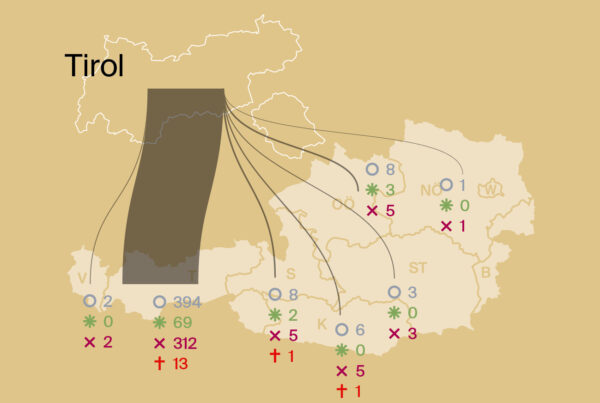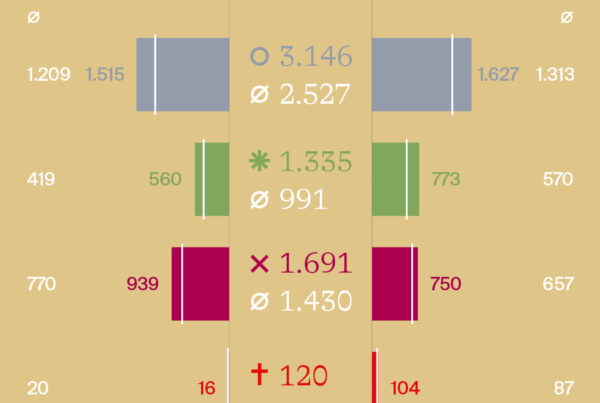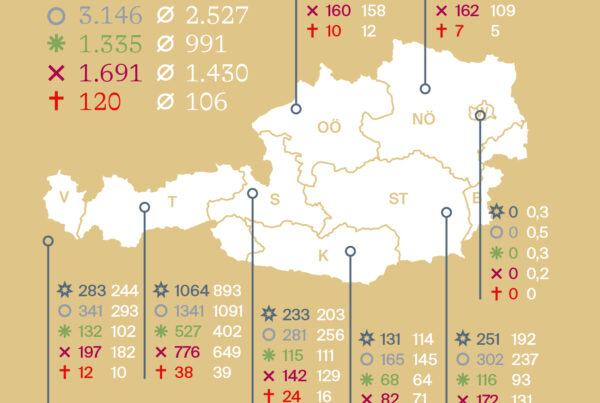Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch
„Der Vorteil: Ich polarisiere. Der Nachteil: Ich polarisiere.“
Der Österreichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) veranstaltet mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) und dem ÖKAS jährlich das Netzwerk Symposium Bergrettung. 2024 ging es u. a. um das Thema „Soziale Medien: Fluch oder Segen“ und Oberst Michael Bauer sprach dazu als Pressesprecher des Österreichischen Verteidigungsministeriums. Dieser Vortrag war das Highlight der Veranstaltung. Niemand hat erwartet, dass gerade das Bundesherr eine moderne und effiziente Krisenkommunikation etabliert hat, welche die verschiedenen sozialen Medien clever verwendet. Warum Oberst Michael Bauer auf seinem Leitkanal X – früher Twitter als Person und unter seinem Namen postet, hat der Krisenmanager des Österreichischen Bundesheeres schlüssig erklärt. Von seinen Learnings und Empfehlungen aus 15 Jahren Berufserfahrung profitierten die Vertreter aller anwesenden Organisationen. Weil die Zeit aber nicht für alle Fragen ausreichte, haben wir nochmals mit Michael Bauer gesprochen.
Im Gespräch:
Michael Bauer
Pressesprecher des Österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung
Interview:
Peter Plattner und Riki Daurer

↑ Michael Bauer nach dem Gespräch mit analyse:berg.
Foto: Carina Karlovits/Bundesheer
a:b
Oberst Bauer, was ist Ihre Aufgabe beim Bundesheer?
MB
Ich bin seit 2010 der Sprecher des Österreichischen Verteidigungsministeriums. Entstanden ist mein Job damals aus einer Krise, die das Bundesheer ausgelöst hat: Bei einer Übung im Februar 2009 wurden mehrere Nebelhandgranaten gezündet, deren Rauch die Sichtverhältnisse auf der Donauufer-Autobahn so verschlechterten, dass eine Massenkarambolage mit einer toten und mehreren schwerverletzten Personen die Folge war. Als Konsequenz der darauf folgenden fatalen Kommunikation des Bundesheeres wurden viele Abläufe geändert. Der Verteidigungsminister hat festgelegt, dass es eine Person geben muss, welche das Gesicht und die Stimme nach außen sein soll und ist. Das betrifft nicht nur die allgemeine Kommunikation, sondern auch und vor allem die Kommunikation in Krisen. Und das mache ich jetzt seit 15 Jahren, wobei mein Schwerpunkt in der Kommunikation mit Medien liegt.
a:b
Welche Kommunikationsfehler waren das?
MB
Wir haben dieses Ereignis analysiert und folgende wesentliche Kapitalfehler wurden gemacht:
- Wir haben nicht eine Person kommunizieren lassen, sondern 13.
- Wir haben ganze zwei Tage für die erste offizielle Presseaussendung benötigt.
- Wir waren nicht transparent; konkret, wir haben nicht immer die Wahrheit gesagt, sondern versucht, uns irgendwie durchzuwursteln.
- Wir haben kein Mitgefühl gezeigt. Ich kann mich erinnern, dass wir damals der Ansicht waren, dass das Zeigen von Mitgefühl eine Art Schuldeingeständnis gewesen wäre. Und wir wussten ja nicht einmal, ob wir tatsächlich schuld sind.
Insgesamt wurden wir für diesen Vorfall mehrere Tage, oder besser gesagt Wochen, durch die mediale Manege „gedroschen“. Was kein Wunder war, schließlich sind wir der Kommunikation sozusagen immer hinterher gehoppelt und konnten nicht mehr aufholen, was wir in den ersten Tagen verabsäumt hatten.
a:b
Waren damals soziale Medien schon ein Thema?
MB
Nein. Das Bundesheer hatte damals weder einen Twitter– heute X – noch einen Facebook-Account. Soziale Medien waren damals zwar das Neue, hatten aber bei weitem nicht diesen Hype und diese Bedeutung wie heute.
Jedenfalls hat der damalige Krisenfall dazu geführt, dass wir durch die Analyse und die Aufarbeitung unserer Fehler quasi „Zehn Gebote“ erarbeiten konnten. Seitdem gab es immer wieder Krisen, die wir aber weit besser und professioneller kommunizierten und bei denen auch die sozialen Medien bereits eine große Rolle gespielt haben.
a:b
Die sozialen Medien mit ihrem Shitstormpotenzial sind Fluch und Segen. Überwiegen für Ihre Arbeit die Nachteile, die Vorteile oder ist es eigentlich ein faires Spiel?
MB
Man kennt die Spielregeln, man weiß, wie die Sache funktioniert. Eine Krise muss nicht zwangsläufig zu einem Shitstorm führen. In der Vergangenheit hatten wir Krisen – davon reden wir, wenn jemand stirbt –, die zwar zu einem höheren Aufkommen und vielen Anfragen auf den sozialen Medien geführt haben, aber zu keinem Shitstorm. Warum? Weil wir transparent, schnell und offen kommuniziert haben. Ein Shitstorm wird immer dann ausgelöst, wenn man Dinge tut, die unnötig sind oder wenn die Spielregeln der sozialen Medien nicht eingehalten werden.
Die sozialen Medien, gerade X, sind als Krisenwerkzeug durchaus geeignet. Sie bieten den Vorteil, viele Menschen in kurzer Zeit zu erreichen. Wir haben die Möglichkeit zu erläutern, dass etwas passiert ist, zu beteuern, dass es uns leid tut und dass wir alles tun, um zu einer raschen Aufklärung und – wenn möglich Wiedergutmachung beizutragen. Wir laden die Leute ein, an diesem Prozess teilzuhaben und Fragen zu stellen.
Was sich im Falle einer Krise durch soziale Medien jedenfalls am deutlichsten verändert hat, ist die Geschwindigkeit. 2009 gingen wir davon aus, dass eine Presseaussendung wenige Stunden nach dem Vorfall früh genug sei. Um heute Erster zu sein – und das wollen wir natürlich sein –, haben wir meiner Erfahrung nach ungefähr 15 Minuten Zeit, um den ersten Tweet abzusetzen.
„Man kennt die Spielregeln.
Eine Krise muss nicht zwangsläufig
zu einem Shitstorm führen.“
a:b
Ist aber jeder Shitstorm eine Krise?
MB
Nein, ich würde den Shitstorm nicht nur negativ sehen. Ich nütze durchaus auch Möglichkeiten, einen kalkulierten Shitstorm – vielleicht auch nur ein Stürmchen – auszulösen. Ein kleines Beispiel dazu: Bei der letzten „Airpower“, der Flugshow in Zeltweg, die alle zwei Jahre stattfindet, ist mir der Speiseplan für die Mitarbeiter in die Hände gefallen. Dieser beinhaltete sowohl mittags als auch abends ausschließlich Fleisch. Wie wir vermutlich alle wissen, sind gerade auf den sozialen Medien viele Menschen, die sich aus diversen Gründen – Fleisch ist ungesund, ist schlecht für die Umwelt u. s. w. – vegan ernähren. Ich habe diesen Speiseplan also ganz bewusst im Wissen gepostet, dass dies zu einer erhöhten Kommunikation, sprich Reichweite, mit kalkulierbaren Folgen führt.
Negativ wird der Shitstorm dann, wenn man nicht weiß, warum zwei Stunden nach einem Post das Netz plötzlich völlig übergeht. Ich habe meistens bereits beim Absetzen eines Pots im Auge, welche Reaktionen dieser auslösen wird.
Ganz allgemein ist ein Shitstorm etwas, wo plötzlich die Reichweite und die Anzahl der negativen Beiträge überdimensional hoch ist – wenn aus dem Mess- bzw. Vergleichsfaktor 100 plötzlich 1.000 wird und die Kommentare ausschließlich negativ sind. Wenn man dann zudem aufgrund der Fülle an Kommentaren nicht mehr zum Nachlesen – geschweige denn zum Antworten – kommt, dann muss man sich eingestehen: Das entgleitet mir jetzt.
Die Kunst ist, einen Shitstorm zu vermeiden, wenn man ihn vermeiden möchte. Aus diesem Grund haben wir beispielsweise auf unserer Facebook-Seite von Anfang an ein Vier-Augen-Prinzip: Jedes Posting wird von zwei Personen vorab gelesen. Formuliert z. B. der Kommandant oder der Öffentlichkeitsarbeiter des Jägerbataillons 24 in Lienz einen Post zu den Inhalten ihrer Gebirgsausbildung, stellt er diesen in eine interne, geschlossene Gruppe und ich und unser Facebook-Verantwortlicher schauen uns diesen Post an. Nur wenn wir beide der Meinung sind, dass alles passt, geht dieser Post online. Mit diesem Prinzip haben wir es bisher auf Facebook tatsächlich geschafft, kein einziges Mal einen Shitstorm auch nur annähernd ausgelöst zu haben.
a:b
Ein Shitstorm ist also vermeidbar?
MB
Ich würde sagen, 80 Prozent sind tatsächlich vermeidbar. Meistens kann man sich ausrechnen was passiert, wenn man gewisse Dinge postet. Manchmal denkt man sich auch erst im Nachhinein, gut, dass hätten wir wissen können.
Und dann gibt es dennoch 20 Prozent, wo man sagt, das haben wir nicht gewusst. Auch hier ein Beispiel: Wir hatten am 26. Oktober zum Nationalfeiertag eine große Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz in Wien. Auf einem Posting von uns sieht man einen Soldaten, der auf seiner Uniform ein Abzeichen trägt, das er eigentlich überhaupt nicht tragen darf und das einen etwas eigenartigen Hintergrund hat. Manche sagen, es sei im äußerst rechten Bereich angesiedelt, manche sogar, es sei aus dem nationalsozialistischen Bereich – es könnte beides sein. Das ist uns „passiert“, weil wir das Abzeichen schlicht nicht gesehen haben.
a:b
Entstehen Shitstorms auch auf fremden Kanälen und haben Sie das auch am Radar?
MB
Ja, entscheidend ist hier die Medienbeobachtung. Es gibt natürlich auch Shitstorms, die irgendwo anders passieren, wo wir aber selbst die Leidtragenden sind. Allerdings sehr selten, weil wir extrem gut vernetzt sind. Zudem gibt es viele Leute, die mir auf X oder auch als Direktnachricht irgendeinen Beitrag von irgendjemandem, der sich kritisch oder negativ gegen das Bundesheer äußerst und den ich tatsächlich nicht gesehen habe, senden. Allein durch diese „Schwarmintelligenz“ vieler Follower, die in irgendwelchen anderen Netzwerken unterwegs sind, kommt es daher wirklich selten vor, dass wir etwas überhaupt nicht mitbekommt, das sozusagen im Nachbartal passiert und sich gegen die eigene Ortschaft richtet.
„Manchmal ist man
eben auch machtlos.“
a:b
Sie kommunizieren auf X nicht als Organisation, sondern als Person mit Ihrem Namen und Gesicht. Das wird Vor-und Nachteile haben.
MB
Die Idee war folgende: Warum folgt jemand der Rettung, der Polizei, der Feuerwehr? Aus Neugierde. Wenn irgendwo ein Blaulicht zu sehen und die Sirene zu hören ist, möchte man wissen, was hier passiert ist, wo der Einsatz stattfindet etc. Aber warum sollte man dem Bundesheer folgen? Dafür gibt es eigentlich keinen Grund, außer man ist selbst Soldat. Und das ist ein kleiner Teil, allein 51 bis 52 Prozent der Bevölkerung – nämlich der weibliche Teil – haben wenig bis kaum Zugang zum Bundesheer. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie bei relevanten Fällen ohnehin über diverse andere Medien entsprechend informiert werden. Warum also sollte man dem Bundesheer folgen? Aus dieser Überlegung heraus wurde die Idee geboren, dem Bundesheer ein Gesicht in Form einer Person zu geben, die durchaus polarisiert, aber damit die Organisation Bundesheer vielleicht auch interessanter macht. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Ich polarisiere. Der Nachteil: Ich polarisiere. Vor ein paar Jahren habe ich meine Follower gefragt, warum sie mir folgen. 50 Prozent haben geantwortet, weil sie mich klasse und interessant finden, weil ich spannende Beiträge poste und sie bisher gar nicht wussten, was das Bundesheer alles macht. Die anderen 50 Prozent sagten sinngemäß, sie würden mir nur deshalb folgen, weil ich so ungut, so ein Ungustl, sei und sie hoffen, ich würde bald wieder irgendeinen Blödsinn posten, damit sie sich aufregen können. Das zeigt schon, es polarisiert und diese Polarisierung ist natürlich ein gewisser Vorteil, aber auch ein Nachteil.
a:b
Im Shitstorm Management ist es ja ein Vorteil.
MB
Auch hier würde ich sagen, es ist ein Vor- und ein Nachteil. Man postet als eigene Person, wodurch man auch Dinge sagen kann wie: „Okay, tut mir leid, ist passiert, war ein Fehler“. Handelt es sich allerdings um eine größere Geschichte und man ist schon mehrere Stunden online, beantwortet Posts und versucht zu besänftigen, dann merkt man selbst, dass die eigene Reizschwelle zu sinken beginnt. Ist man fünf Stunden lang nur mit negativen Dingen konfrontiert, macht das etwas mit einem und man muss aufpassen, nicht selbst unsympathisch zu erscheinen. Andere raten mir dann oft, das Handy mal eine Stunde lang wegzulegen, herunterzukommen und erst dann wieder einzusteigen. Für solche Hinweise muss man dankbar sein, selbst bekommt man das manchmal gar nicht so mit.
a:b
Als Person allein online so schnell für eine Organisation zu reagieren, setzt eine hohe Entscheidungsbefugnis voraus.
MB
Das ist richtig. Ich muss überhaupt nichts abstimmen. Das war von Anfang an so. Einmal musste ich einen Tweet aufgrund einer politischen Vorgabe löschen. Ich sage jetzt aber nicht, unter welchem Minister das war.
Rein zeitlich geht sich eine solche Abstimmung nicht aus und aufgrund meiner Erfahrung – ich bin seit 1999 im Pressebereich tätig – weiß ich auch, was geht und was nicht geht. Ich übe meine Funktion beim Bundesheer jetzt unter dem siebten Minister bzw. der siebten Ministerin aus. Keine dieser Personen würde ich jemals kritisieren, auch wenn er oder sie schon lange nicht mehr im Amt ist.
a:b
Wie schaut Ihr Team aus?
MB
Ich bin Leiter der elfköpfigen Presseabteilung des Bundesheeres. Manchmal greife ich darauf zurück, doch eher selten, weil die Aufgabe der Presseabteilung ist ja nicht X, sondern die Kommunikation mit den Medien in herkömmlichen Bereichen.
Aktuell habe ich aber z. B. gerade einer Mitarbeiterin den Auftrag erteilt, ein Sommerrätsel für die nächsten drei Wochen auszuarbeiten, wo auf X jeden Tag eine Frage über das Bundesheer gestellt wird. Bei meinen Tweets greife ich auch auf unsere Facebookseite zurück und hole mir von dort Dinge, die für mich interessant sind. Über das ganze Jahr verteilt sind es vielleicht 40 Prozent an Tweets bzw. Posts, die nicht alleine von mir kommen.
a:b
Möchten Sie mit den sozialen Medien primär Journalisten und andere Medien servicieren oder auch den einzelnen User erreichen?
MB
Hie muss man unterscheiden: Ich persönlich betreibe in meiner Funktion und unter meinem Namen nur den X-Account des Bundesheeres. Das ist ein dienstlicher Account, wo ich nichts Privates poste, sondern ausschließlich bezüglich Bundesheer und Militär kommuniziere.
Aber das Bundesheer betreibt ja nicht nur X durch mich, sondern mit einer eigenen Abteilung Facebook, TikTok, einen YouTube Kanal, Instagram und Flickr ich glaube ich habe nichts vergessen – und jeder dieser Kanäle ist völlig unterschiedlich.
Ein kleines Beispiel: Ich poste auf X einen Beitrag A, der eine bestimmte Reichweite hat und auf Facebook überhaupt nicht vorkommt. Dann gibt es aber auch einen Beitrag B, der auf Facebook ein großes Thema wird, auf Twitter aber überhaupt nicht zu lesen ist. Die Zielgruppen, die wir bedienen, sind also völlig unterschiedlich.
Auf Facebook sind eher mittelalterliche Männer unterwegs, die entweder beim Bundesheer sind oder waren, und dort grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht haben. Diese Gruppe ist uns wohlgesonnen, sie will lässige, klasse Informationen über das Bundesheer lesen, um sich selbst bestätigt zu fühlen und sich zurückzuerinnern.
Auf Instagram sprechen wir eher jüngere Menschen an – auch hier leider relativ männlich dominiert – die das Bundesheer klasse finden und, wenn sie entsprechend alt genug sind, auf alle Fälle dazu gehen möchten. Die Themen sind dort tendenziell actionreicher, hier wird geschossen, gesprengt, mit dem Fallschirm gesprungen und geklettert.
Die Menschen auf X stehen uns sehr kritisch gegenüber. Teilweise lehnen sie das Bundesheer auch ab, etwas, das wir auf Facebook und Instagram überhaupt nicht haben. Sie wollen mit dem Bundesheer eigentlich nichts zu tun haben, einige finden aber das, was ich poste, durchaus interessant und schauen sich die Inhalte immer wieder an.
X hat jedenfalls ein unglaubliches Potenzial. Wird ein Beitrag von mir von jemandem retweetet oder kritisch kommentiert, der selbst eine große Reichweite hat – z. B. Armin Wolf, der X in der Zwischenzeit allerdings verlassen hat –, dann lesen plötzlich nicht mehr wie üblich 20.000 Leute mit, sondern eine halbe Million.
a:b
Bei einem Shitstorm auf Facebook oder Instagram sind auch Sie Ansprechpartner?
MB
Nein. Meine Aufgabe dort ist ausschließlich, einen Beitrag zur Veröffentlichung freizugeben oder nicht – wobei mein „Nein, geht nicht“ kaum vorkommt. Aber das konkrete Shitstormmanagement macht dort jemand anderer.
a:b
Welche Bedeutung hat Fehlerkultur in diesem Zusammenhang?
MB
Fehlerkultur und Transparenz sind wesentliche Aspekte bei Krisen.
Intern setzen wir uns nach jeder Krise zusammen und besprechen offen, was gut war, was wir verbessern und was wir anpassen müssen. Obwohl sich unser Krisenkommunikationsplan seit 15 Jahren bewährt hat, finden wir immer wieder Punkte, die wir ändern müssen.
Nach außen hin bedeutet das, sich auch entschuldigen zu können. Klar zu sagen: „Da haben wir einen Fehler gemacht, das war falsch und wir entschuldigen uns dafür.“ Gerade auf X reagieren die Leute oft überrascht und finden ein solches Bedauern anständig und ehrlich, zumal sie das vom Bundesheer vielleicht nicht erwartet hätten.
a:b
Morgen stürzt einer eurer neuen Leonardo-Hubschrauber ab und es gibt zwei Tote. Wie würde die Krisenkommunikation ablaufen?
MB
Nach einer „Kommunikationsuhr“, die wir u. a. tatsächlich anhand des konkreten Beispiels eines Hubschrauberabsturzes erstellt haben:
Die Krisenkommunikation beginnt sofort und sehr schnell auf X und bleibt im Wesentlichen dort.
Auf Facebook und auf Instagram wird zwei, drei Stunden später ein Post mit dem Inhalt geschalten: „Es ist etwas passiert, leider zwei Tote, ein tragisches Ereignis u. s. w.“ Aber das war es dann schon wieder, denn auf Facebook und Instagram sind die Fans des Bundesheeres, deren Reaktion sinngemäß sein wird: „Wahnsinn, das ist wirklich tragisch und hoffentlich wird das alles wieder gut“. Daher bleibt das Schwergewicht der Krisenkommunikation auf X, denn dort wird die Meinung vorherrschen: „Wahnsinn, ihr seid schlecht geflogen, die Leute wurden nicht gut ausgebildet. Habt ihr die Hubschrauber nicht gewartet? Skandal, was ist denn da schon wieder passiert?“
a:b
Werden je nach Ereignis manche Medien bevorzugt?
MB
Im Prinzip läuft das umgekehrt. In einer Krise brauchen wir unsere Geschichten nicht anzubieten.
Wir werden angerufen. Wenn es ein Ereignis ist, wo jemand gestorben ist, dann gibt es ein österreichweites Interesse. Bei anderen Ereignissen ist natürlich v. a. das regionale Interesse hoch, z. B. bei einem Unfall in Oberösterreich werden die Oberösterreichischen Nachrichten in ihren Print- und Onlineausgaben ausführlicher berichten. Für uns bedeutet eine Krise aber immer, ununterbrochen Telefonanrufe zu beantworten.
a:b
Wie schaut es mit einer Presseaussendung aus?
MB
Unsere Vorgabe im Krisenkommunikationsplan ist, dass eine Stunde nach dem Ereignis die Presseaussendung draußen sein sollte. Ein Zeitpunkt, zu dem wir üblicherweise schon zwei, vielleicht sogar drei X-Posts draußen haben. Aber wenn eine Krise eintritt, dann beginnen wir sofort, eine Presseaussendung zu formulieren und erfahrungsgemäß ist nach einer Stunde ein guter Zeitpunkt, um mit dem aktuellen Stand die Aussendung rauszulassen. Ist das erledigt, beginnt sofort die Arbeit an der folgenden zweiten Presseaussendung.
a:b
Was steht in der Presseaussendung?
MB
Da muss man jetzt unterscheiden:
Die erste Presseaussendung beinhaltet im Wesentlichen: Wer? Was? Wann? Wie? Wo? Z. B. Heute um 10:00 Uhr ist an diesem Ort das und das passiert, es gibt Tote, es gibt Verletzte, die Untersuchungskommission ist dabei, wir bedauern das, die Verstorbenen bzw. die Verletzten waren aus jenen Bundesländern und so und so alt, schon so und so lange beim Bundesheer u. s. w. Viel mehr weiß man nach einer Stunde meist noch nicht. Ganz bewusst ist hier z. B. auch noch kein Zitat der Ministerin enthalten.
In der zweiten Presseaussendung, die zwei bis drei Stunden später hinaus geht, wird noch einmal alles wiederholt, es gibt aber mehr Details und die Ministerin wird zitiert. Im Wesentlichen kommunizieren wir das, was wir wissen und was gesichert ist – wir halten nichts zurück. Dasselbe gilt auch auf X, wo dann vielleicht alle fünf Minuten gepostet wird und alle zwei, drei Stunden werden alle Informationen zusammengefasst und als Presseaussendung rausgegeben.
a:b
Diese Offenheit beeindruckt, doch es geht ja auch um Schuldfragen und rechtliche Konsequenzen. Wie offen kommunizieren Sie hier?
MB
Ganz ehrlich war das bisher kein echtes Thema. Am Rande haben wir manchmal darüber gesprochen, z. B. im vergangenen Jahr, als in einer Kaserne ein Soldat von einem anderen erschossen wurde. Hier hatten wir einen Clinch mit der Polizei, weil diese die Kommunikation übernehmen und natürlich primär die Staatsanwaltschaft informieren wollte. Wir haben nach gewohntem Ablauf das gesicherte Wissen kommuniziert. Wir geben aber nur etwas nach außen, wenn es durch Check, Recheck und Doublecheck hundertprozentig gesichert ist.
Auch hier wieder ein Beispiel: Wir hatten vor fast zehn Jahren einen Hubschrauberabsturz, bei dem ein Soldat gestorben ist und zwei schwer verletzt wurden. Eine knappe Stunde nach diesem Absturz meldete sich der Chefpilot des Bundesheeres, mit – ich glaube – über 6.000 Flugstunden und sagt mir, was seiner Meinung nach die Ursache für den Unfall war. Eine Flugunfallkommission hat ein Jahr Zeit, um die Absturzursache festzulegen und der ruft mich eine Stunde später an. Um es vorwegzunehmen: Was er mir gesagt hat, hat gestimmt und war genau das, was die Unfallkommission nach einem Jahr herausgefunden hat. Aber das habe ich natürlich nicht kommuniziert, schließlich kann man das Ergebnis der Flugunfallkommission nicht vorwegnehmen. Mir hat es die Kommunikation aber sehr viel leichter gemacht, weil ich davon ausgehen konnte, dass man menschliches Versagen ausschließen wird können und es auch kein technisches, sondern ein aerodynamisches Problem war, welches bei Hubschraubern auftreten kann.
Ich würde also nie Dinge kommunizieren, die der Polizei oder Justiz vorbehalten sind. Aber das, was ich gesichert weiß, kommuniziere ich. Mit einer einzigen Ausnahme: Wir kommunizieren keine Namen. Weder von Verletzten noch von Toten.
a:b
Wie geht ihr mit Unfallfotos um?
MB
Wir kommunizieren keine Fotos der Verstorbenen oder Verletzten. Ein Foto, auf dem ein Mensch zu erkennen ist, ist ein absolutes No-Go. Meiner Erfahrung nach dauert es – und da sind wir wieder bei den sozialen Medien zwei bis maximal vier Stunden, bis die Journalisten den Namen und damit auch die Fotos haben.
Andere Unfallfotos teilen wir aber ohne Einschränkungen. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Unfall mit einem gepanzerten Fahrzeug mit zwei lebensgefährlich Verletzten. Auf den Unfallfotos war das Fahrzeug so beschädigt zu sehen, dass man es kaum mehr erkennen konnte. Es gab eine Diskussion, ob wir die Bilder veröffentlichen sollen und ich habe entschieden, dass wir das natürlich tun. Schließlich haben wir nichts zu verheimlichen. Es ist etwas passiert. Ob wir schuld sind, wissen wir noch gar nicht. Es hat zwar Schwerverletzte gegeben, aber das verunfallte Fahrzeug kommunizieren wir.
Warum sollten wir das zurückhalten? Was passiert, wenn wir es zurückhalten? Dann kommt sofort der Vorwurf, man hätte etwas zu verbergen, es sei ganz anders gelaufen, als gesagt wurde. Die Journalisten beginnen erst recht zu recherchieren. So aber sagen wir: „Ja, schaut her, so ist es gewesen und da ist das Foto.“
a:b
Ich frage für andere Organisationen: Wo und wie finde ich jemanden wie Sie?
MB
Organisationen leben natürlich auch von den Menschen, die für sie nach außen kommunizieren. Letztlich bin ich ein Produkt meiner Organisation.
Diese, also das Bundesheer, hat auch viel investiert: Ich durfte vor 25 Jahren die Ausbildung zum deutschen Presseoffizier machen, lernte zwei Wochen bei der Schweizer Armee und absolvierte viele Interviewtrainings, Seminare, das Journalistenkolleg u. s. w. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben. In fünf Jahren werde ich in Pension gehen und mein Nachfolger, Major Marcel Taschwer, ist seit fünf Jahren bei mir in der Abteilung. Dort hat er die Möglichkeit, insgesamt zehn Jahre mitzulaufen und alles kennenzulernen. Er wird seinen Job natürlich anders als ich machen – ob besser oder schlechter, müssen dann andere beurteilen. Aber ich gebe ihm zumindest all das mit, was ich weiß und kann.
Letztendlich erfolgt die Kommunikation also immer über Menschen. Diese muss man finden, ausbilden und fördern, damit sie ihre Arbeit gut und gerne machen können.
„In einer Krisensituation liegen
70 Prozent des Erfolges
in der Vorbereitung.“
a:b
Warum sind Sie fast schon unsympathisch begeistert von Ihrem Job?
MB
Weil er jeder Tag anders ist, was ihn spannend und vielfältig macht.
Kürzlich haben wir unsere Themen der letzten Jahre aufbereitet: Von der Rückrufaktion von Schuhen aus krebserregenden Materialen, Auslandseinsätzen, das Jagdkommando und Soldatinnen bis zum Eurofighter, der einen Heißluftballon abfing, ist alles dabei.
Wir haben einen eigenen Friedhof und Postämter, Schulen, Apotheken, Flughäfen, einen ganzen AlpinSektor mit Bergführern u. v. m. Langweilig wird es also nie und nach all den Jahren gibt es immer noch Themen, wo ich mir denke: Das hatten wir noch nie.
Es ist einfach wahnsinnig spannend und abwechslungsreich, in dieser riesigen Organisation mit 55.000 Mitarbeitern zu arbeiten. Ganz ehrlich: Ich würde meinen Job für keine andere Organisation machen.
a:b
Ihre Tipps für alpine Organisationen und Krisen?
MB
Das Wichtigste ist die Vorbereitung. Ich empfehle jeder Organisation mögliche Szenarien durchzuspielen. In einer Krisensituation liegen 70 Prozent des Erfolges in der Vorbereitung.
Wird man ohne Vorbereitung mit einer Krise konfrontiert, wird man ziemlich sicher scheitern. Wenn ich aber mit dem Wissen in eine Krise gehe, das alles schon einmal durchgearbeitet, auch wenn es nur ein Trockentraining war, zu haben, dann wird es funktionieren. Das ist wie Bergsteigen und Training: Ohne die notwendige Kondition werde ich zusammenbrechen und die Tour nicht schaffen oder habe danach einen solchen Muskelkater, dass ich nicht mehr gehen kann. War ich aber davor laufen oder am Rad, dann geht es leichter und besser.
Zweiter Punkt: Es muss jedem klar sein, wer in einer Krisensituation welche Aufgaben übernimmt. Das muss vorab definiert sein, denn während der Krise lässt sich das nur schwer zuteilen.
Und drittens ist in einer Krise heutzutage der Faktor Zeit entscheidend. Wenn ich nicht schnell genug bin und es schaffe, die Welle rechtzeitig aufzuhalten, dann wird sie über mich hereinbrechen. Und damit sind wir wieder bei den ersten beiden Punkten, denn ohne Übung und Zuteilung der Aufgaben kann man nicht schnell und gut arbeiten.
Beispiel gefällig? Vor kurzem hatten wir in Österreich eine Übung mit der Schweizer Armee, bei der drei Unfälle passiert sind. Da wir mit unseren Schweizer Kollegen aber bereits zwei Monate davor virtuell verschiedene Krisensituationen durchgespielt hatten, bei der viele Dinge aufgepoppt sind, die wir sofort optimieren und abstimmen konnten, hat die Aufarbeitung und Kommunikation wesentlich besser funktioniert. So konnten wir uns bei den tatsächlichen Unfällen dann auf die Probleme konzentrieren, die wir nicht beseitigen konnten. Die Vorbereitung ist also das Allerentscheidendste.
Links & Publikationen:
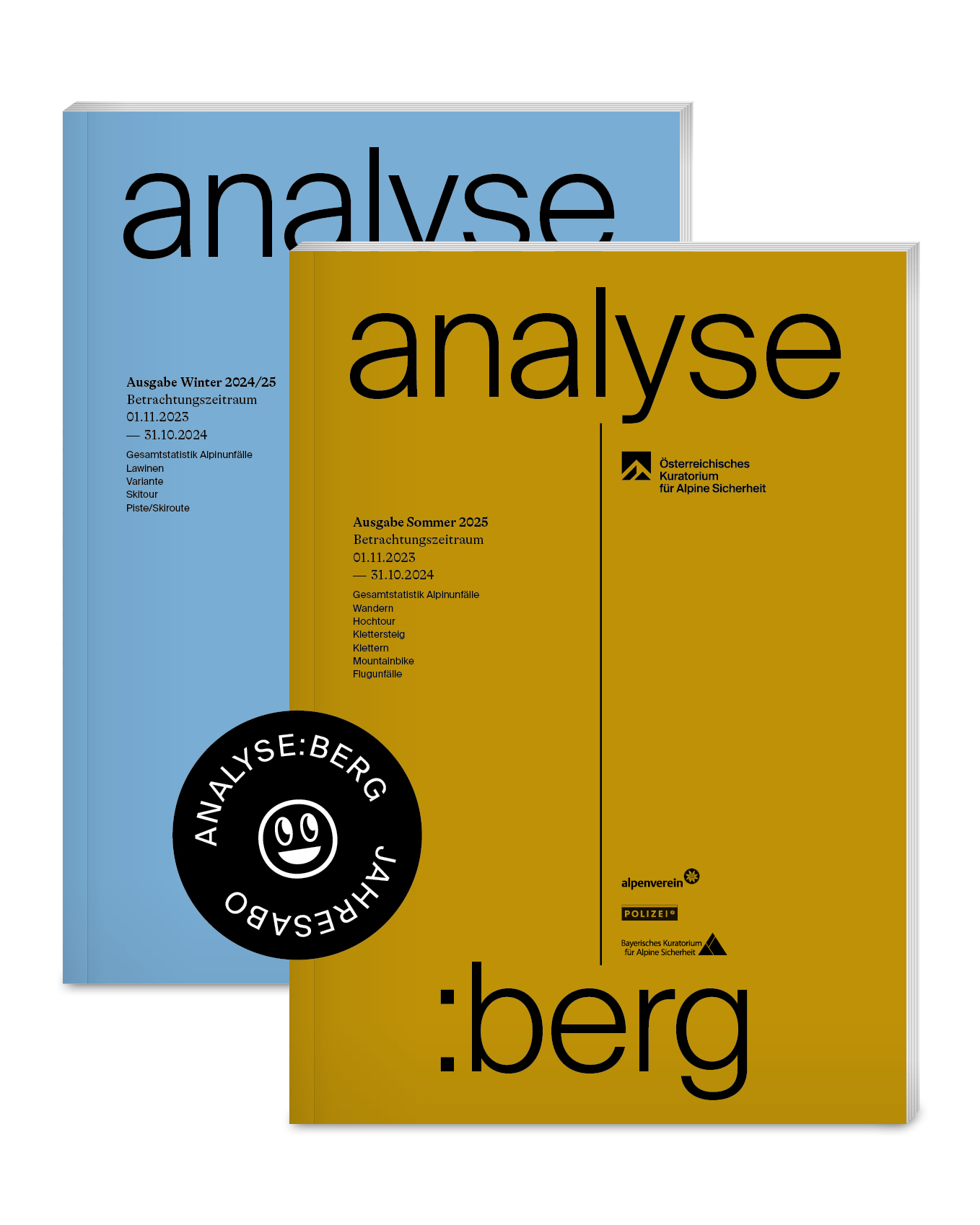
- Dieser Beitrag ist im ÖKAS Fachmagazin analyse:berg Sommer 2025 (Betrachtungszeitraum: 01.11.2023 bis 31.10.2024) erschienen.
- Chefredakteur: Peter Plattner (peter.plattner@alpinesicherheit.at)
- Abo Magazin analyse:berg Winter & Sommer
- Alpin-Fibelreihe des Kuratoriums
- Alpinmesse / Alpinforum 2025
- Kontakt ÖKAS:
Susanna Mitterer, Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Olympiastr. 39, 6020 Innsbruck, susanna.mitterer@alpinesicherheit.at, Tel. +43 512 365451-13