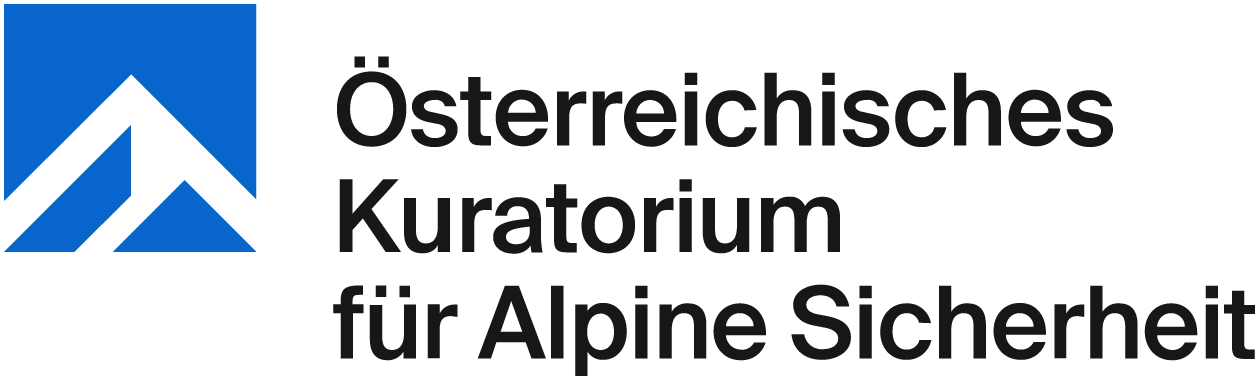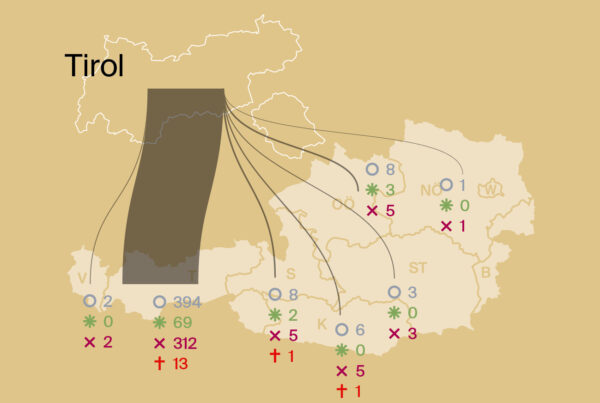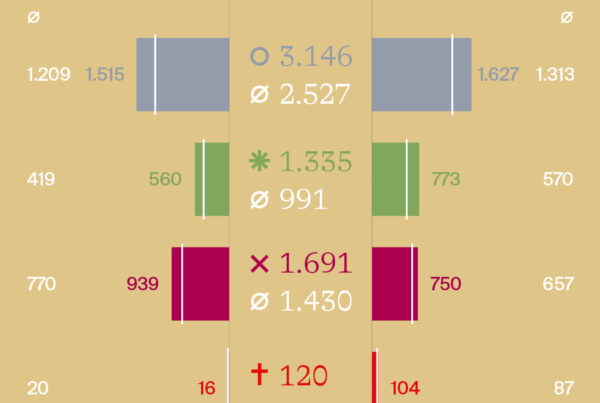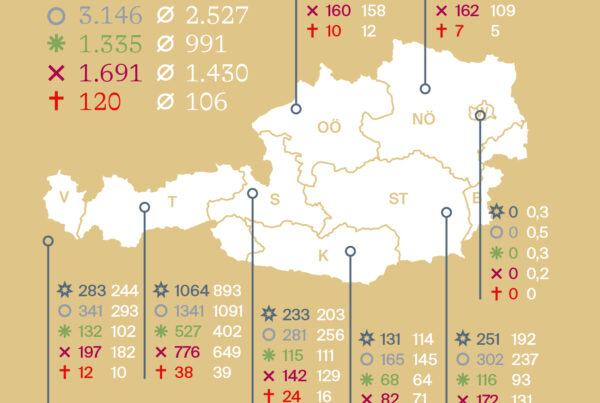Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch
„Digitale Welt und Realität dürfen nicht widersprüchlich sein.“
Das Interreg-Projekt DIGIWAY hat das Potenzial, sich zu einem Meilenstein in Sachen Tourenplanung und Unfallprävention beim Bergwandern zu entwickeln. Wir haben beim Land Tirol, dem Tiroler Projektpartner, nachgefragt, was DIGIWAY ist, welche Ziele es verfolgt und welche Möglichkeiten sich durch ein qualitätsgeprüftes digitales System des Wander- und Bergwegenetzes ergeben können.
Im Gespräch:
Klaus Pietersteiner
Land Tirol, Abteilung Waldschutz, Fachbereich Landschaftsdienst
Lucia Felbauer
Geografin, Projektkoordinatorin DIGIWAY
Interview:
Peter Plattner, Christina Schwann

↑ Lucia Felbauer und Klaus Pietersteiner nach dem Gespräch mit analyse:berg.
Foto: argonaut.pro
a:b
Was ist das Projekt DIGIWAY?
KP
Das Projekt DIGIWAY ist ein Interreg-Italien-ÖsterreichProjekt der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner NOI Techpark. Finanziert wird das Projekt über Interreg – gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre, von Jänner 2024 bis Jänner 2026 mit einer Verlängerung bis Ende Juni 2026.
Entstanden ist das Projekt aus dem Projekt RAGNAR, bei dem es vor allem um die Risikoanalyse Steinschlag entlang von Wander- und Bergwegen geht. Daraus hat man im Amt der Tiroler Landesregierung die Notwendigkeit erkannt, die Datenlage rund um das Wander- und Bergwegenetz zu verbessern, um Wanderern und Bergsteigerinnen bessere Möglichkeiten der Tourenplanung zu geben und aufbauend auf qualitätsgeprüften Daten Entscheidungen treffen zu können. In Summe ist es ein sehr facettenreiches Projekt.
a:b
Was bedeutet das konkret?
LF
In der Tat liest sich auch der Projektantrag ein wenig nach Allem und Nichts und es bedurfte durchaus einer Findungsphase im Projektteam. Schließlich hat sich herauskristallisiert, dass wir zum einen bestehende Daten – also jene Geometriedaten des Wegenetzes, die wir von den Ländern zur Verfügung gestellt bekommen zusammenführen wollen. Praktisch kann man sich das wie beim grenzübergreifenden Lawinenlagebericht vorstellen: Auch wir wollen die Daten grenzüberschreitend zusammenführen, harmonisieren und der Öffentlichkeit anbieten. Um das zu automatisieren – und zwar nicht nur einmalig, sondern langfristig und auch laufend aktualisierend –, wird zur Zeit eine entsprechende Software von MovingLayers geschrieben.
Der zweite Schwerpunkt umfasst zwei Pilotstudien einmal im Fassatal und einmal entlang des Fernwanderweges E5, der durch alle drei Regionen führt –, im Rahmen derer wir uns einzelne Themen rund um das Bergwandern herausgepickt haben. Hier wollen wir neue Konzepte erproben, um zu sehen, ob sie funktionieren und ob siespäter auch von anderen Stakeholdern übernommen werden können. Ein Beispiel ist die Klassifizierung von Wander- und Bergwegen und wie man hier die aktuelle Situation der unterschiedlichen Klassifizierungssysteme verbessern kann.
a:b
Wer ist die Zielgruppe des Projektes?
KP
Tatsächlich gibt es mehrere Zielgruppen. Im Endeffekt ist es aber der Endverbraucher – sprich der Wanderer und generell Menschen, die sich auf den Wander- und Bergwegen bewegen. Zielgruppe sind aber auch Wegehalter, die ihre Infrastruktur aufgrund dieser Daten besser digital erfassen können. Eine weitere Zielgruppe sind Behörden, die Verwaltung – so wie etwa mein Fachbereich: Wir fördern Instandhaltungsarbeiten und für uns ist es interessant zu wissen, wer ist auf welchem Abschnitt Wegehalter, wie schwer ist der Weg, wie viele Einbauten gibt es auf diesem Abschnitt? Daraus lässt sich abschätzen, ob 500 Meter Stahlseil auf diesem Teil des Weges gerechtfertigt sind oder nicht. Zielgruppe können im Weiteren auch Rettungsorganisationen wie die Bergrettung sein.
LF
Eine zusätzliche Aufgabe des Projektes sehe ich darin, zwischen den sehr unterschiedlichen Wegehaltern – alpine Verein, Tourismusverbände, Gemeinden etc. – zu vermitteln, was wir aufgrund unserer neutralen Stellung ganz gut können.
KP
Auch Naturschutz ist de facto ein Thema. Schließlich ist das wichtigste Besucherlenkungswerkzeug am Berg ein gut beschildertes und gewartetes Wegenetz. Auch können Naturschutzthemen in einer digitalen Welt sehr gut transportiert werden.
a:b
Alle Wegehalter, egal ob von den alpinen Vereinen oder von Tourismusverbänden, haben ihre eigene Software, ihre Tools. Dazu gibt es im Web zig Tourenportale, die Wandervorschläge, Lenkungsmaßnahmen, Schwierigkeitsbewertungen etc. vorstellen. Auch gibt es offizielle Karten. Seid ihr mit diesem Projekt nicht ein bisschen spät dran?